 |
Band 24
Datenschutzerklärung auf der Indexseite
|
Band 24 in der Buchreihe "Zeitzeugen des Alltags"
|
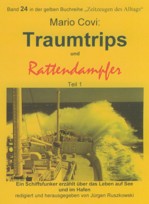
|
Band 24 in der gelben Buchreihe „Zeitzeugen des Alltags“
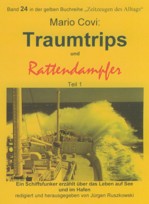
Traumtrips und Rattendampfer
Mario Covi
erzählt in diesem Band aus seiner Seefahrtzeit. Er befuhr von 1962 bis 1990 als Schiffsfunker in der weltweiten Tramp- und Linienfahrt die Ozeane. Er schreibt über ein Leben zwischen Abenteuer und Beruf. So führen seine Geschichten in entlegene Ecken der Welt. Sie handeln von einsamen Wochen auf See und der steten Sehnsucht nach den Dingen hinterm Horizont. Von wilder Lebenslust in wüsten Hafenkneipen und vom schmerzvollen Abschied-nehmen. Aber auch vom Niedergang der deutschen Handelsflotte als frühem Opfer der Globalisierung. Themen wie Schmuggel, Piraterie, blinde Passagiere, das rätselhafte Verschwinden von Schiffen, Unfälle, Seenot, der Tod von Kameraden und der stete Traum vom Traumtrip wird reichlich Raum gewährt.
Lesermeinung zu Band 24:
Der Band "Traumtrips und Rattendampfer" ist ein sehr gut gelungenes Abbild der Seefahrt. Endlich hat jemand den Mut zu einer ehrlichen Darstellung, besonders "hinter den Kulissen", gefunden. Vieles kann ich nur bestätigen, einiges war auch für mich neu. Hervorzuheben und beeindruckend sind die geschilderten Hierarchieverhältnisse an Bord, das zwangsweise Zusammenleben aller Besatzungsmitglieder, die wahre Beschreibung bei Begegnungen mit der 3. Welt sowie das tabulose Darstellen aller Lebensgewohnheiten an Bord und bei Landgang. Auch ist es unbegreiflich, was Profitsucht aus einem Menschenleben machen kann! Alle Härten auf See, aber auch die Schönheiten der Welt sind vom Funker Mario Covi in ausgezeichneter Weise dargestellt. Bestimmt könnten viele ehemalige Seeleute dicke Bände schreiben, aber leider hat nicht jeder das Talent von Herrn Covi dazu. Oft verblassen auch die Erinnerungen zu schnell und so wird vieles bedauerlicherweise ungesagt bleiben. --- Nochmals vielen Dank für die interessanten Aufzeichnungen von Herrn Mario Covi und auch für die Bemühungen zum Druck von Herrn Jürgen Ruszkowski.
Peter J.
Bände 24 und 25 in der gelben Buchreihe „Zeitzeugen des Alltags“
Jürgen Ruszkowski, Nagelshof 25, D-22559 Hamburg
Tel.: 040-18090948 - Fax: 040-18090954
vergriffen - kein Neudruck mehr
nur noch als ebook bei neobooks
- nur noch als ebook bei neobooks und vielen großen Händlern und als kindle-e-book bei amazon neu in 3 Teilen direkt vom Autor Mario Covi eingestellt
Inhalt: Band 24
1. Vom Salzgeschmack der Ferne
2. Sehnsucht nach den alten Pötten
3. Lagos Reede
4. Regenzeit
5. Vom Regen in die Traufe
6. In Afrika ist Regenzeit (Lied)
7. Landgang in Alex
Leseprobe:
Nach vier Tagen Außen-Reede Alexandria verholten wir unerwartet auf die Innenreede dieses als ‚Perle des Mittelmeeres‘ nicht gerade schimmernden Hafens. Wir hatten uns auf ein gemütliches Wochenende gefreut und mit mindestens ein, zwei Wochen Wartezeit gerechnet. Letzte Reise hatte die MARIANNE B. (Name geändert) sogar drei Wochen am Schlickhaken geschwoit. Dicht an dicht lagen hier mindestens weitere vierzig Frachter.
Aus der Nähe sah die Stadt vielversprechender aus. Kuppeln und schlanke Minarette drängten aus dem saharafarbenen Häusermeer. Auffallend der Prachtbau der ehemaligen ägyptischen Könige, der Ras-El-Tin-Palast, von dem einst Faruk ins Exil gejagt wurde.
Nachmittags gingen wir an unseren Liegeplatz, einen für das Militär reservierten Kai. Das Längsseitsgehen glich einem Eiertanz, denn das Hafenbecken war von zahllosen verbeulten Schuten und uralten hölzernen Lastkähnen verstopft, die allesamt vollgetürmt waren mit Kisten, Kästen, Bündeln und Ballen. Auf den vorsintflutlichen Barken flüchteten Gestalten in zerfetzten und vor Dreck starrenden ‚Ghallabijas‘ vor dem drohenden Schiffskörper. Sie hätten trockenen Fußes, von Boot zu Boot springend, das Bassin überqueren können. Mit viel gutturalem Gezeter, Schiffssirenengeheul und Schlepperhilfe gelangten wir durch dieses ‚Wuhling‘ und machten am Kai fest. Vor uns lag ein chinesischer Frachter, aus dessen Räumen unzählige Geschütze an Land gesetzt wurden. Ballerdinger, mit denen sich immer die Falschen goldene Nasen verdienen. Unsere Ladung war etwas ziviler: eine von vielen Fuhren Eisenbahnwaggons aus Rumänien zu fünfunddreißig Stück.
Für mich war’s der erste Landgang in Alex. Von meinen Bordkameraden war nicht viel zu erfahren. Kaum einer hatte Zeit, viele auch keine Lust, an Land zu gehen. Da sei ein Nachtklub, ‚Crazy Horse‘, da gehe man schon mal hin...
In den sechziger Jahren bin ich oft genug in arabischen und levantinischen Häfen gewesen, kann mich an ein aufregendes Port Said erinnern, an die Medina von Casablanca (und die Storys über ‚Dödel-Wilma‘), an die tausend Jahre alte Stadtmauer von Sfax, die Souks von Tripolis, den Basar von Benghasi. An die libysche Wüste im Frühling, den Goldbazar und die Ramadan-Böllerschüsse von Dubai, an Sandstürme und Straßensperren in Aden. Die dreiste Aufdringlichkeit arabischer Händler und Bootsfahrer im Suezkanal ist mir bekannt, mit Kameraden bin ich von libyschen Gassenjungen mit Steinen beworfen worden, und meiner neugierigen Kamera waren gezielte Tomatenwürfe im libanesischen Beirut zugedacht. Was stellte ich mich also so an und fragte so blöd? Also, hinein ins Unbekannte!
Der Hafen selbst war zunächst ein Schock. Alles das, was Handel und Wirtschaft der internationalen Kauffahrtei-Schifffahrt anzuvertrauen wagten, stapelte und türmte sich, lag durcheinander, zerbrach, lief aus, gammelte, stank und verschwand zum Teil auch auf Nimmerwiedersehen. Fast der gesamte Außenhandel dieses einst nur von biblischen Plagen gebeutelten Landes ging zwangsläufig über Alexandria.
Nach zweimaliger Landgangspasskontrolle war ich endlich im Wahnsinnsgetöse einer Vier-Millionen-Stadt. Ein Maultierkutscher verfolgte mich: „Hans, willst du Kuuutsche farren?“ – Ich versuchte sein Vehikel als Deckung zu nehmen, um durch den wütenden Verkehr heil in den Schatten der hohen Häuser zu gelangen. – „Du, komm! Kuuutsche farren, billig, billig!“ Fast hätte mich ein Wahnsinnsding von LKW erwischt. Der Fahrer lachte; schwarze Locken, schwarze Augen, Allah ist groß!
Schließlich ein Platz. Souvenirschuppen mit Ramsesramsch und Pyramidenplunder. Die Sphinx als Aschenbecher, als Briefbeschwerer, auf Messing, auf Leder. Ach ja, die Nofretete auch! Ein stattlicher Kerl, einer von vielen ‚Ali-Achmeds-aus-Berlin‘, hängte sich an meine Fersen. Ich wurde den Kerl nicht los. Wir gingen in eine der seltenen Kneipen mit Alkoholausschank, wo mich Ali auf meine Kosten zu einem Bier einlud. Er erzählte, dass er mit Silberschmuggel viel Geld verdient habe. Es war gerade ein Jahr her, dass auf den Weltmärkten innerhalb kurzer Zeit der Silberpreis hochgepuscht worden war. Münzen und alten Beduinenschmuck nach Italien, mit Autos zurück nach Ägypten. Mir waren bereits etliche Wagen, vorzugsweise der Marke Mercedes, mit verwittertem D-Schild aufgefallen. Aber Ali war bestimmt ein ehrlicher Schmuggler und kein Autoknacker!
Ali hatte mich hellhörig gemacht. Durch winkelige Gassen führte er mich zu einem der unzähligen Silberhändler, dessen Laden, nicht viel mehr als ein vitrinenähnlicher Kasten, buchstäblich auf dem Pflaster der Gasse stand. Hinter Glas eine reiche Auswahl an Amuletten, Ringen und Reifen. In Blechdosen verwahrte er Münzen und schwere Fuß- oder Armreifen: Brautschmuck der Beduinen. Eines dieser Stücke mit Verzierungen aus tordiertem Silberdraht hatte es mir angetan. Das alte Nomadengeschmeide brachte 135 Gramm auf die Waage. Ali feilschte prahlerisch laut mit dem stillen Händler, gurrte, schmeichelte, umarmte ihn, küsste ihn schließlich – und konnte seine Vermittlerprozente kassieren.
Endlich allein schlenderte ich durch das abendliche Basarviertel und trottete über Pflastersteine, deren abgewetzte Oberfläche vom Schliff bewegter Jahrhunderte zeugte. Ich stöberte in Tante-Emma-Läden. Da gab es säuberlich aufgereihte Säcke voll würzig riechender Spezereien. Aus klobigen klemmenden Schubladen wurden für ein paar Piaster Koriandersamen oder Weihrauchharz in grobes Packpapier geschaufelt. Ich kam durch Gassen, wo bei nächtlichem Funzellicht Sessellehnen geschnitzt oder Intarsien in Tische gesetzt wurden. Die niemals durch Fragen des Geschmacks verunsicherte Hand des Meisters dirigierte lernende Jungenhände. Quallige Möbel wurden liebevoll mit Zuckerbäckerstuck verziert und zum protzig-plüschigen Prunk fürs Volk, handwerklich solide und termitenfest.
Welch ein Treiben! Ärmlich gekleidete Fellachen, verschleierte Frauen, kichernde Schulmädchen, modisch gekleidete Schönheiten. Nubier, dunkelhäutig, in weiß wallenden Umhängen und Turbanen, düster wirkende Kopten, bleichgesichtige Griechinnen und großnasige Armenier waren ebenso in der Menschenmasse vertreten wie die unzähligen lärmenden Kinder oder die alten Männer mit ihren Patriarchenköpfen.
Marktstände säumten die größeren Basarstraßen. Da türmte sich Obst, Gemüse, Haushaltskram, Kleidung, lag klebrig-süßes Backwerk neben Datteln und Zuckerrohrstangen. Fisch und Langusten wurden von Fliegen umschwirrt und Katzen umlagert. Dann Käfigtürme voll Federvieh. Und unzählige Kaninchen. In einer Ecke ein Blechfass, in dem sie – gekauft und für gut befunden – geschächtet rasch verbluteten. Auf den Dächern der Schlachtereien trockneten im Großstadtsmog Fleischwaren, die von Gestellen baumelten wie Gehängte. Zwischen all dieser Farbenpracht verzweifelt hupende Autos, fluchende Kutscher, der zum Gebet rufende Singsang eines Muezzin aus einer der unzähligen Moscheen...
Neugierde, dieser altvertraute Drang, trieb mich in dunkle Viertel. Doch bald sah ich wieder Licht, erreichte eine sich hofartig erweiternde Sackgasse. Musik war zu hören, und ich entdeckte hinter einer feierlich gekleideten Männergesellschaft verwegen aussehende Musikanten. Einige Männer stellten sich in Reihen auf, wiegten sich im verhaltenen Klagen des Vorsängers. Von Zeit zu Zeit beugten sie ihre Oberkörper weit zurück, Arme gen Himmel und lächelten verzückt, um dann in Gegenrichtung rumpfbeugend der Erde zuzustreben. Die Musik steigerte sich, einer von allen erwarteten Ekstase entgegendrängend. Trommeln und Tamburine wirbelten, festigten sich zu komplizierten Rhythmen. Flötenphrasen schlängelten sich um die präzisen Schläge der Perkussionsspieler. Der kehlige Gesang wurde aufpeitschender. Da schwang etwas in der Stimme des Wüstensohnes, das an fanatisierte, burnusflatternde Reiterhorden mahnte, die mit Feuer und Schwert einem alle Ungläubigen vernichtenden ‚Mahdi‘ folgten...
Aber dann beherrschte nur noch Trance die Tänzer, Hingabe an fetzende Synkopen, ekstatischer Singsang. Die Männer wirbelten, warfen sich vor und zurück, ‚Ghallabijas‘ wallten und Schweiß tropfte von verzückten Gesichtern.
Die Musik verstummte, die Szene löste sich auf. Der verzaubernde Bann verwehte wie eine letzte Flötenkadenz, wie fremdartiger Blütenduft, der von fernem Gestade einem einsamen Seemann in die Nase steigt und ihn rätselnd allein lässt.
Ich wollte mich in die Nacht verdrücken, war jedoch längst erspäht worden. ‚Schai‘, der allgegenwärtige stark gesüßte Tee, wurde mir gereicht, ein Stuhl bereitgestellt. Dies sei eine Hochzeitsfeier, erklärte man mir. Erstaunt fragte ich nach der Braut, nach den auf solchen Festen nirgendwo fehlenden Frauen und Mädchen. Eine Hand wies nach oben. Ich erhaschte einen Blick auf neugierig herablächelnde Frauensleute und Kinder, die von Balkonen und in Fenster gelehnt dem Treiben im Hof folgten. Meine Frage: „Und die Frauen tanzen nicht?“ wurde mit Gelächter quittiert. Nein, das seien religiöse Tänze, Lobpreisungen Gottes.
Als die Musikanten wieder nach ihren Instrumenten griffen, forderten mich die jungen Männer zum Tanzen auf. Ich winkte ab, seltsam berührt von dieser ganz anderen Art Männerwelt, in der Tanz und körperliche Berührung frei von jenen Tabus sind, mit denen wir die Grenzen zwischen Männlichsein und Unmännlichkeit abzustecken das Recht in Anspruch nehmen.
Die ägyptischen Jünglinge deuteten meine Zurückhaltung sicherlich als europäische Steifheit, als tapsig-unmännliche und amusische Tölpelhaftigkeit. Als die Musik erneut ihre drogenähnlichen Reizstoffe in die wirbelnde Menge sprühte, fingen die Zuschauer den synkopischen Rhythmus der Trommler auf und klatschten anfeuernd mit. Da sah ich als rhythmustrainierter Funker eine Chance, das angeknackste Image des Fremden zu korrigieren und schlug begeistert den ungewohnten Takt sauber mit, was die tanztrunkene Männerrunde mit anerkennenden Rufen belohnte.
Leseprobe:
Während eines Abendspaziergangs – wir lagen seit einigen Tagen im türkischen Mersin – kollidierte ich an einer hohen Bordsteinkante mit einem Afrikaner. Um uns gegenseitig vor einem Absturz in den Straßenverkehr zu bewahren, umarmten wir uns kichernd und einigten uns spontan, Entschuldigungen auf englisch zu formulieren. Das ließ uns in diesem sprachlichen Niemandsland gleich fröhlich weiterpalavern, das übliche Woher und Wohin und Natürlich-auch-Seemann...
Das kurze kontaktfreudige afro-europäische Zusammenspiel wurde von zwei älteren türkischen Herren beobachtet, die dem Hallo Sympathie abgewannen. Mit radebrechender Wissbegier fragten die türkischen ‚Beis‘, ob der schwarze Seemann ein Filipino sei, was dieser, sich als Tansanier vorstellend, mit der Pointe konterte: „Erst gestern bin ich für einen Chinesen gehalten worden!“ - Fremdländische Begegnungen waren an dieser provinziellen Küste scheinbar noch eine Seltenheit...
Der tansanische Afrikaner mit Namen Muhamed und ich verplauderten den Abend in einer Kneipe. Im begeisterten Rückbesinnen an ostafrikanische Zeiten fiel mir manche Redensart in Kisuaheli ein, und bald klönten wir über Muhameds Heimat, die bergeskühlen Hänge des Kilimanjaro. Muhamed kam aus Marangu, war also ein Spross der Chagga, ackerbautreibende Nachbarn der hamitischen Massai-Hirten. Die Chagga sind ein zähes Volk von Bergbewohnern, die sich bei Exkursionen auf die beiden Gipfel des mit rund 6000 Metern höchsten Bergs Afrikas als Lastenträger einen ähnlichen Namen gemacht haben, wie die Sherpas im Himalaja. Die Frage, wie ein sehniger Chagga zur Seefahrt gelangte, war mir als allerdings wenig bergzähem Österreicher dann doch zu blöd. Wissenswerter erschien mir das Warum seiner Odyssee, denn der 26-jährige Muhamed hatte seine nebelumwölkte Heimat unterm Äquator seit vier Jahren nicht mehr gesehen.
Er erzählte mir, dass er im Augenblick arbeitslos sei und auf ein Schiff lauere. Als Maschinenmann, sei’s als ‚Oiler‘, als Heizer, Motormann oder Ingenieur-Assistent hatte er sich bisher auf meist abenteuerlichen Pötten durchs Leben geschlagen. Sein letztes Schiff, ein Grieche, hatte er in Indien verlassen müssen, da es verkauft worden war. Der Kapitän, gleichzeitig Eigner, hatte seinen Reibach gemacht. Die Crew hatte er kurzerhand auf die Straße gesetzt, hire and fire! – „So bin ich eben von Indien als ‚Hitchhiker‘ bis Piräus getrampt“, berichtete er weiter. „Doch in Piräus einen Dampfer zu finden ist aussichtslos. Zu viele griechische Seeleute sind selber arbeitslos, und an allen Ecken im Hafen lauern Afrikaner und Asiaten auf einen Job. Also bin ich nach Mersin zurückgetrampt in der Hoffnung, bessere Chancen zu haben...“
Aber jetzt, und er zeigte seine dürftig verarztete rechte Hand, sei ihm auch noch das da passiert. Beim Kochen in einer schäbigen Absteige, die er mit einigen Schicksalsgenossen teilte, war der Petroleumkocher explodiert. Natürlich konnte ich ihm keinen Job auf unserem Schiff besorgen, aber Muhamed war glücklich, wenigstens auf ein zuhörendes Ohr gestoßen zu sein. Um sein schwaches Budget wissend lud ich ihn zu einem Kebab-Imbiss ein und schob ihm einen Zwanzigmarkschein zu, den er sichtlich nötig hatte, um im Dschungelkampf zu überleben, in den er verwickelt war. Denn es war ein Dschungelkampf (und ist es noch immer), den zahllose Afrikaner, Asiaten und Lateinamerikaner in den Häfen der Welt durchzustehen hatten. Wenn sie Schiffe abklappernd einen Job suchten, sich einschlichen an Bord, unterwürfig um eine Heuer baten mit ihren oftmals obskuren Seefahrtbüchern, windigen Zeugnissen und erschlichenen Bescheinigungen. Wenn sie abgewiesen, zum x-ten Male als Kanaker angepöbelt und von Bord gejagt wurden. Wenn sie sich schließlich verhasst machten als diebische Hafenstreicher, als Beachcomber mit ihrem gottverdammten Spruch: „Please, Sir, I’m looking for a job...“
In der Seeschifffahrt herrschte eine bedrückende Situation. Die Selbstverständlichkeit, mit der wir unsere Arbeitsplätze als sicher betrachtet hatten, bröckelte zusehends. Auch mir saß das Hemd näher als die vergammelten Jeans, und ich sah es gar nicht gerne, wie Filipinos uns immer mehr Schiffe ‚wegnahmen‘, weil sie eben billiger waren. Doch verschob sich da nicht etwas? Nicht der Filipino war der Gegner, sondern derjenige, der uns ebenfalls zu Filipinos und Muhameds machen wollte, weil er in seiner unbarmherzigen Gewinnkalkulation nicht bereit war, Arbeitsplätze unter deutscher Heimathafenflagge zu fairen deutschen oder europäischen Bedingungen zu erhalten. Hier hinein passte die simple Kalkulation eines Kapitäns, der, ich zitiere einen Artikel aus ‚Die Zeit‘ vom 5. Dezember 1975, „... seine jetzige Asiaten-Crew nach Auslaufen der Verträge durch Türken ersetzen wird: ‚Die Heuern, die wir jetzt zahlen müssen, lassen uns keine andere Wahl. Sechs Türken bringen soviel wie zehn Indonesier, so kommen wir wieder klar‘...“
Um schmerzender Brotlosigkeit zu entgehen, verfielen heuersuchende Hafenstreicher oft auf die Idee, sich als blinde Passagiere mitnehmen zu lassen. Wenn sie dann auf See aus ihren Verstecken gekrochen kamen, musste man sie halt irgendwie beschäftigen. Meistens durften sie, für drei reichliche Mahlzeiten pro Tag, kräftig die Rosthämmer schwingen. Es konnte allerdings auch passieren, dass so ein ‚Stowaway‘, der natürlich etliche Scherereien mit Behörden und Reederei verursachte, über die Kante ging. Wenn er Glück hatte, mit Flüchen im Rücken und einer mäßigen Chance, das nahe Land schwimmend zu erreichen. Oder, wie auf dem deutschen Panamafrachter „Margitta“, die meuchelnden Hände hinter und des Meeres Grabestiefe vor sich. Auf der „Margitta“ war Anfang der siebziger Jahre ein somalischer ‚Blinder‘ dem Ersten zu lästig geworden. Das hatten ein paar Männer der Crew als Aufforderung zur Beseitigung des Afrikaners verstanden und dies gehorsam und gemeinsam erledigt. Die Täter hatten allerdings ihr Fett wegbekommen. Der Erste, glaube ich, sogar lebenslänglichen Freiheitsentzug. Fast wären ja ihre Köpfe, kraft krummschwertschwingender Henkersknechte sachgerecht vom seemännischen Rumpf getrennt, in jemenitischen Wüstensand gekullert. Die Diplomatie war rechtzeitig eingeschritten, so dass den Männern islamische Rechtsprechung erspart geblieben war und sie aus jemenitischer Gefangenschaft deutschen Kadis zugeführt worden waren.
1974 fuhr ich auf einem 12.000 BRT großen Frachter unter rot-weiß-roter Flagge meines Heimatlandes. Falls noch nicht bekannt, auch Wien war ein zur Schiffsregistrierung gerne bereiter Ausflagghafen. Eines Sonntags befanden wir uns, von Takoradi in Ghana kommend, auf 4 Grad Nord und 6 Grad West. Es war der 15. September, tropisch das Klima, und beim sonntäglichen Preisschießen wurde mir mit 65 Punkten der vierte Preis zuerkannt: ne Buddel Sekt – und den Underberg für die Folgen.
Da kamen mit einem Mal zwei zerzauste krausköpfige Gestalten um die Ecke geschlurft, einfach so, ein langes Etmal von der ghanaischen Heimat, oder woher auch immer die schwarzen Burschen herkommen mochten, entfernt. Ein trink- und zielfreudiger Rest der Schützengilde schaute der Begegnung erwartungsvoll grinsend zu. Also maßte ich mir markiges, einschüchterndes Offiziersbellen an und ließ die schwarzkrausen Kerle erst mal strammstehen bei der peinlichen Frage, was zum gottverdammten Donnerwetter sie denn hier zu suchen hätten. Und sie standen stramm, rollten mit den Augen und sahen in den luftgewehrbewaffneten Sonntagszechern sicherlich schon ein kolonialistisches Kaffernkillerkommando, es war irgendwie beschämend...
Ich erklärte ihnen, dass sie mir zum Kapitän folgen sollten, nachdem ich diesen sanft auf den sonntäglichen Schock vorbereitet hatte. Als ich die Stowaways wenige Minuten später abholte, hatte sich ein dritter dazugesellt. Alle drei versicherten in bestem Pidgen-English: „No more black man go come, Sir!“ Also, ab zum Alten!
Der Alte, ein gewichtiger Seebär, Freund guten Whiskys und deftiger Grünkohlgerichte, veranstaltete ein titanisches Feuerwerk donnergrollenden Kapitänzorns. Rot vor Wut ließ er sämtliche Fucking-damned-Flüche als gotteslästerlichen Schauer über die drei Schwarzen niederprasseln, ein levitenverlesender Anschiss eindrucksvollster Art! Auch die ‚Blinden‘ waren begeistert, sie sanken auf die Knie und bettelten unterwürfig: „Wir wollen doch nur Arbeit, Sir! Wir arbeiten auch nur fürs Essen, Sir!“ – Dem Alten reichte die Luft noch zu einem imposanten: „Raus!!!“ und einem bereits milderen: „Meldet euch beim Chief-Mate!“ - Und als die schwarzen Schwarzfahrer kleinlaut davonhuschten, sagte er: „Arme Kerle! Aber ich musste erst mal ein Donnerwetter veranstalten, das bin ich der Situation schuldig.“ - Als ich daraufhin gleichfalls verschwinden wollte, bekam ich die der Situation entsprechende Order: „Los, Funki, schenk uns erst mal einen ein!“
Die blinden Passagiere durften dann fleißig die Rostmaschine fahren, ein Job, dem die Matrosen an Deck alles andere als mit Vergnügen nachgingen. Stundenlang war man bei dieser Arbeit betäubendem Lärm und grässlichem Roststaub ausgesetzt.
Als wir am zweiten Weihnachtstag im belgischen Gent einliefen, mussten wir einen langwierigen Papierkrieg mit der Polizei ausfechten, denn blinde Passagiere waren jeder Einwanderungsbehörde ein Dorn im Auge. Meist gingen sie ja auch das Wagnis des Sich-heimlich-Wegstauens ein, weil sie der Hölle des Hungerleidens in ihren Heimatländern zu entkommen suchten im Glauben, in Europa sei illegales Von-Bord-Schleichen ein Eintritt ins milch- und honigschäumende Paradies. Den Schiffsleitungen blieb da in der Regel nur die Wahl, entweder selbst für das Anbordbleiben der ungebetenen Fahrgäste zu sorgen, oder, gegen Gebühr versteht sich, gleich der Polizei die Einkerkerung zu überlassen.
Viel besser erging es den Burschen auch nicht, als sie an Bord in eine nach allen Regeln der Seemannskunst verriegelte und verrammelte Kajüte gesteckt wurden. Und doch gelang manchem Illegalen die Flucht. Wurde er rechtzeitig gefasst, musste ihn das Schiff wieder mitnehmen. Wurde er später aufgestöbert, musste die Reederei für den Rücktransport ins Hungerland sorgen. Wir bekamen unsere drei maritimen Trittbrettfahrer jedoch unbeschadet über die Runden und lockenden Hafenzeiten. Das kalte Winterwetter trug das Seine dazu bei, das Einschleich-Schlaraffenland Europa weniger arkadisch erscheinen zu lassen. Wir transportierten die drei jungen Ghanaer sowie eine volle Ladung Klinkerzement wieder Richtung Afrika.
Das Jahr 1975 war angebrochen. Winterliches Sturmgebraus wurde von südlicher Sonne ins Vergessen gedrängt, als wir Westafrikas Küste erreichten, wo – so erklärte mir einmal ein Kapitän – kein Wetter mehr, sondern nur noch Klima herrschte. Er meinte damit das beständige, gleichförmige, waschlappenfeuchte Tropenklima dieser von Stürmen verschonten Region. So brackerten wir durch Permanentklima und ruhige See und schossen wieder mal am schützensonntäglichen 5. Januar die Augen aus den Zielscheiben. Mit 101 Ringen brachte mir das sogar den 1. Preis: diesmal ne Buddel Whisky und eine Stange Zigaretten für mich militanten Nichtraucher...
Sieben Tage später wurden wir in Abidjan, dem Paris Westafrikas, wie es die Weißen gerne genannt wissen, das Mitfahrerproblem los. Einer der blinden Passagiere desertierte noch rasch, während die anderen beiden den offiziellen Weg gingen: über die Gangway hinein in die polizeilichen Mühlen schwarzafrikanischen Bürokratismus. Dass wir vier Tage später bereits wieder einen ‚Blinden‘ aus Ghana an Bord haben sollten, ahnten wir da noch nicht!
Eines Tages im August 1976, als ich auf einem Stückgutfrachter im Liniendienst zwischen Frankreich und den frankophonen Ländern Westafrikas fuhr, hatten wir gleich neun schwarze Schwarzfahrer an Bord. Und alle neune waren mit Hilfe mitleidloser Schlepper in Abidjan oder Lomé auf das Schiff geschmuggelt worden. Gegen hartes Schmiergeld und mit dem Versprechen, der Pott brächte sie eilends und direkt ins Paradies. Nur: unser Kahn setzte seinen Kurs Richtung Südost nach Kamerun und Gabun ab, und die neun Stowaways aus dem Binnenland Mali, dem riesigen Wüstenstaat im Hungergürtel Afrikas, fuhren vom Regen in die Traufe. Vom sozialistisch orientierten Sahelstaat in das westlichem Neokolonialismus hofierende Urwaldland Gabun des Hadsch Omar Bongo. Malier konnte man dort nicht ausstehen, wie uns die Polizisten in Libreville grinsend versicherten. Also, auch hier keine Spur von Brüderlichkeit...
Als die neun Einschleicher entdeckt worden waren und allesamt in der Brückennock zwecks Befragung durch den Kapitän strammzustehen hatten, stellte sich bei vielen Besatzungsmitgliedern erschreckend rasch eine Art aggressiver Bereitwilligkeit ein. Eine Selbstherrlichkeit den Sich-im-Unrecht-Befindlichen gegenüber. Im Unrecht zu sein schien gleichbedeutend mit rechtlos zu sein. Wir balancierten auf einem äußerst schmalen Grat. Des Alten bedenklicher Rassismus, zu dem er sich freimütig bekannte ohne ihn als solchen zu bezeichnen, ließ eine fast sinnlich prickelnde Stimmung aufkommen. Eine Atmosphäre, wo der bekannte Funke zur Explosion, das Fingerschnippen zur Lynchjustiz führt. Damit will ich nicht behaupten, dass der Kapitän dies gutgeheißen hätte. Aber es war unverkennbar, wie einige Männer im vermittelten Glauben, es hier mit miesen niederzuknüppelnden Meuterern zu tun zu haben, darauf brannten, dem erstbesten, der aufzumucken gewagt hätte, eins aufs Maul zu hauen.
Rückblendend muss ich erläutern, dass unser Kapitän im langjährigen Südafrikadienst die reaktionäre Burenideologie in seine eigene konservative Weltanschauung hatte einfließen lassen. Auch ganz allgemein hing er der selbstgefälligen Gesinnung einer elitären Oberschicht an. Er fühlte sich als rassisch Privilegierter aus der dogmatischen Denkart heraus, dass Nichtweiße zu gewissen Dingen einfach nicht fähig sind. Er war ein angenehmer Unterhalter, schätzte gute Bildung, liebte exzellenten Rotwein und heiße Diskussionen. In meinem Hang zu widerborstigem Oppositionsgeist flogen bei uns des Öfteren die Fetzen. Erst einige Tage zuvor hatten wir ein Streitgespräch geführt, in dessen Verlauf er nicht davon abzubringen gewesen war, dass, wer arm sei und hungert, selbst Schuld daran trage. Er solle halt arbeiten... Und nun standen sie da, die neun Malier, die nichts weiter wollten als dorthin zu fahren, wo sie Arbeit zu finden glaubten.
In vielen Häfen, in denen mit Einschleichern zu rechnen war, wurden vor Auslaufen die Laderäume, Kammern, Maschinenraum, Winkel und Ecken durchsucht, um den für alle Seiten unliebsamen Problemen aus dem Wege zu gehen. Der Kapitän eines deutschen Trampschiffes entledigte sich der unerquicklichen Tatsache, einen Stowaway an Bord zu haben, auf seine Weise. Als er durch die Fischgründe vor Westafrikas Küste tuckerte, winkte er einen Fischkutter heran und ließ Zigarettenstangen zeigen. Auf diese Weise signalisierte er den Fischern, ein nicht unübliches Geschäft – Fisch im Tausch gegen Zigaretten und Schnaps – auf hoher See abwickeln zu wollen. Er ließ den Fischerkahn längsseits kommen und drängte darauf, das Fahrzeug ordentlich zu vertäuen und festzumachen. Das Misstrauen der Afrikaner beschwichtigte er freundlich palavernd und mit Zigarettenstangen, die er den Männern zuwarf.
Als der Kutter fest war, kam auf Kommando Leben in die Seeleute des Frachters. Ein sachgerecht gefesselter und geknebelter blinder Passagier wurde in Windeseile von starken Seemannspranken über die Verschanzung gehoben und Hand über Hand in das Fischereifahrzeug gefiert. Gleichzeitig kappten die Männer die Leinen, der Dampfer ging auf volle Fahrt voraus – und unter Gejohle und wütendem Protestgeschrei war das Stowaway-Problem für den deutschen Trampdampfer gelöst. Auf eine zwar pfiffige, aber doch recht grobe und hinterhältige Weise, die man Kuckucksei-Methode nennen könnte...
Als ich Mitte der Sechzigerjahre auf einem kleinen Hochseeschlepper durch den Indischen Ozean schaukelte, erzählte mir der Dritte, mit dem ich eine enge Kajüte teilte, wie er mit Frau und kleinem Sohn aus der DDR geflüchtet war. Als Erster Offizier eines DDR-Frachters hatte er nur für seine Frau eine offizielle Mitreisegenehmigung erhalten. Seinen Jungen jedoch hatte er, durch Schlafmittel betäubt, als kleinen Stowaway so raffiniert versteckt, dass ihn die Polizisten, als sie das Schiff nach so genannten Republikflüchtlingen durchkämmten, nicht entdeckten. Von Rostock bis Schweden war es daraufhin vergleichsweise nur noch eine Spielerei. - Der blinde Passagier als politischer Flüchtling, als Fliehender, als Schutzsuchender...
Im Norden Madagaskars, in Diego Suarez, waren noch Anfang der Siebzigerjahre eine Menge Fremdenlegionäre stationiert. Einige deutsche Legionäre nutzten die Gelegenheit, auf einem mit deutschen Offizieren besetzten Panamafrachter ins Zivilleben zu desertieren, was ihnen ohne freundschaftliche Hilfe kaum gelungen wäre. Auf einem dieser Panamapötte im Maskarenen-Inseldienst, auf dem ich lange Zeit arbeitete, kursierte die Story von einem besonders schlauen Legionär. Dieser hatte, im Hinblick auf die rigorosen Durchsuchungen des Militärs, den absolut sicheren Schlupfwinkel für einen blinden Passagier gefunden. Besser gesagt, er glaubte ihn gefunden zu haben. Weil diese Schiffe in Diego Suarez immer mehrere Wochen in der Werft lagen, waren Kontakte mit den Legionären gang und gäbe. Und dieser eine hatte nun kurz vor Auslaufen aus dem Dock seinen drahtigen Körper durch ein offenes Mannloch in den Doppelbodentank des Schiffes gezwängt. Seemännisch unbedarft konnte er nicht ahnen, was ihm dort unten drohte. Seine verzweifelten Hilferufe und Todesschreie werden beim Fluten der Ballasttanks im Dröhnen der Maschinen untergegangen sein. Es dauerte ein halbes Jahr, da legte sich die Leiche des Legionärs vor den Saugkorb der Lenzleitung und machte, als der Doppelbodentank wieder einmal leer gepumpt werden sollte, auf das Drama aufmerksam, das sich dort unten abgespielt hatte. Für die Fremdenlegion war der Deserteur nicht mehr auffindbar gewesen, also nicht mehr existent und somit ein Strich durch den höchstwahrscheinlich falschen Namen eines Namenlosen...
Der Kapitän meines ersten Schiffes – er hatte mir einmal vorgeworfen, nie ein strammer Offizier zu werden, weil ich in grünschnabeligem Leichtsinn die Nachtfalterreize einer kolumbianischen Schönen der pünktlichen Rückkehr an Bord vorgezogen hatte - war eine verwitterte alte Teerjacke. Ein Sailor alter Schule, der auf amerikanischen Segelschiffen im Pazifik den Horizonten nachgejagt war. Seine letzte Seereise – er war längst pensionsberechtigt – sollte wahrlich seine letzte Reise gewesen sein: Er war kurz nach dem Einlaufen in einen wintersturmgepeitschen Hafen oben in Schottland gestorben. Dieser alte Fahrensmann hatte gerne mal von alten Zeiten erzählt. So auch von einem Zossen, der so voller Ratten gewesen war, dass man ihn hatte ausgasen müssen.
„Und als wir den Dampfer hievenweise von toten Ratten säuberten“, beendete der Alte seine Geschichte, „fanden wir zwei tote blinde Passagiere in den Windhutzen. Norweger. Die hatten sich durch die Luftschächte an Deck retten wollen, doch wir hatten ja die Windhutzen dichtgemacht, damit das Gas im Schiff blieb...“
Eine weitere Story über Stowaways erzählte mir ein nautischer Offizier auf mein Tonbandgerät: „...Man nimmt an, dass sich die blinden Passagiere auf diesem Kühlschiff in Kolumbien hatten einstauen lassen, um nach Europa zu kommen. Denen wurde es allerdings da unten ganz schön kalt. Die Bananen werden nämlich auf dreizehn Grad runtergekühlt, das heißt der Luftstrom, der da durchweht, der mag vielleicht elf Grad haben. Jedenfalls haben die dann Bananenkartons auseinandergepackt und daraus in der Luke ein Feuerchen gemacht. Und nun fing natürlich auf der Brücke sofort der Rauchmelder an zu bimmeln. Man nimmt zwar an, dass die (auf der Brücke) geahnt haben, was da los war. Aber sie haben bloß gesehen, dass Rauch aus der Luke kam, haben alles dicht gemacht und CO2 reingepumpt. Und als das Schiff dann in Bremerhaven gelöscht wurde, fand man irgendwann drei an CO2-Vergiftung gestorbene Männer...“
19. Jimmy, unser Decksmann aus Ghana (Lied)
Jimmy, unser Decksmann aus Ghana (Eine Ballade)
Eine CD mit den Liedern von Mario Covi kann bei ihm bezogen werden
Jimmy, unser Decksmann aus Ghana
Er wollte weg von Afrika, der Hunger trieb ihn fort
Jimmy, unsern Decksmann aus Ghana.
Als man ihn fand, versteckt in Luke zwo
Jimmy, unsern Decksmann aus Ghana
Schlug ihn der Bootsmann aus Spaß erst mal k. o.
Jimmy, unsern Decksmann aus Ghana.
CHORUS: Jimmy, einer unter vielen, die der Hunger lockte auf ein Schiff
Jimmy, einer unter vielen, gestrandet wie auf einem Riff
Jimmy, du wirst trotzdem verhungern, an Bord frisst dich die
Einsamkeit
Jimmy, du wirst dich noch wundern über unsre
Unbarmherzigkeit
Der Alte tobte, schrie, und sagte dann
Zu Jimmy, unserm Decksmann aus Ghana:
Fürs Fressen musst du schuften, am besten fang gleich an!
Jimmy, unser Decksmann aus Ghana.
Er klopfte Rost, er tat es gern und willig
Jimmy, unser Decksmann aus Ghana
Der Erste sagte: So ´ne Arbeitskraft ist billig!
Jimmy, unser Decksmann aus Ghana.
Er war ja eigentlich ein ganz vernünft`ger Macker
Jimmy, unser Decksmann aus Ghana
Der Bootsmann aber hasste ihn und nannte ihn Kanaker
Jimmy, unsern Decksmann aus Ghana.
CHORUS: Jimmy...
Doch dann gab sich der Alte einen Ruck
Und sprach zu Jimmy, unserm Decksmann aus Ghana
Du wirst jetzt echt gemustert, bekommst ein Seefahrtsbuch
Als Jimmy, unser Decksmann aus Ghana.
Nur der Bootsmann, der hasste unsern Macker
Jimmy, unsern Decksmann aus Ghana
Er ärgerte und quälte ihn und schimpfte ihn Kanaker
Jimmy, unsern Decksmann aus Ghana.
CHORUS: Jimmy...
Und eines Nachts drehte der Schwarze durch
Jimmy, unser Decksmann aus Ghana
Und schnitt dem Bootsmann ganz sacht die Kehle durch
Jimmy, unser Decksmann aus Ghana.
Dann wankte er an Deck – und sprang über Bord
Jimmy, unser Decksmann aus Ghana
Der Alte strich den Namen, setzte die Reise fort
Ohne Jimmy, unsern Decksmann aus Ghana
Ohne Jimmy, unsern Decksmann aus Ghana
Ohne Jimmy, unsern Decksmann aus Ghana.
49. Plaudereien – und vom Verlust der Redlichkeit
Vor einiger Zeit blickte ich vom einstigen Ende der (europäischen) Welt, dem portugiesischen Kap São Vicente, hinaus auf den Nordatlantik und grübelte darüber nach, wie viele Jahre diese schier endlosen Gewässer meine – und vieler anderer Seeleute – Heimat gewesen ist...
Doch zurück ins Jahr 1981. Aus den ebenso schier endlosen Tonbandplaudereien hatte ich einige Abschnitte mit dem TOA (Technischer Offiziers-Assistent) Tjard herausgesucht. Tjard *) war sechs Jahre bei der Handelsmarine, zuvor aber vier Jahre bei der ‚marineblauen Trachtengruppe‘, wie ich gerne lästerte.
„Ja, das war auch weltweit. Großes Natogeschwader, Japan, Australien, Indien, dann rüber in die Staaten“, erzählte der Dreißigjährige. „Da haben wir auch so ´n paar Gags mitgekriegt. Die meisten, die wir an Bord hatten, waren wirklich Grüne, also total unerfahren. Da war einer, der hatte schon mal tagsüber gepaddelt (gesteuert), musste nun aber die erste Nachtwache ans Paddel...“
Tjard erklärte, dass vorne, wo die Gösch (kleine Nationalflagge) gesetzt war, ein rotes Lämpchen brannte und fuhr fort: „Der Ablöser, der neben dem Grünhorn stand, fragte: ‚Siehst du da hinten an Land den roten Punkt?‘
‚Ja, den seh´ ich!‘
‚Pass auf, da fährst du jetzt genau drauf zu!‘
Der Neue setzt sich hin, das erste Mal nachts am Paddel, und er ist am Steuern und denkt, dass er das ganz prima macht...“
„Der erste Offi oben auf `m Turm, so halb eingeduchtet, konnte sich bis jetzt immer auf die Leute verlassen, guckt auf einmal nach hinten. Kommt aus seinem Stand raus, fällt nach Steuerbord, fällt nach Backbord und schreit nach unten: ‚Was ist denn los?‘
‚Wieso, bis jetzt fahr ich genau auf dieses Licht da zu!‘
Der Erste guckt raus: ‚Wat für `n Licht? Wir sind hier mitten auf `m Atlantik!‘
‚Da vorne, das rote Licht. Ist doch sicher ´ne Insel oder so wat!‘
Da wär´ der Erste fast auf ´n Arsch gefallen. Hat nur noch geknurrt: ‚Ablösung!!!‘“
Wir zogen noch kräftig und unreflektiert über die Marine her, wussten von Keilereien zwischen ‚echten‘ Seeleuten und diesen Hampelmännern in ihren Kieler Knabenanzügen, lästerten über Uniformfetischismus, dort wie hier bei der christlichen Seefahrt. Der Assi war auch auf einigen ausgeflaggten Passagierschiffen gefahren, wo Uniformen nun mal dazugehören. Unser Erster, der ebenfalls auf Musikdampfern gefahren war, hatte einmal zynisch die Fähigkeiten für dieses Metier auf folgenden Nenner gebracht: „Das ist was für Playboys, da musst du saufen und bumsen können!“
Der Ing-Assi schilderte genüsslich eine ‚Affen-Show‘: „...Alle Offiziere haben schöne weiße Uniformen, und bei so ´ner Affen-Show stellt der Kapitän in der Bar seine Leute vor. Der ganze Raum ist dann voll, bei uns waren’s meistens alte Weiber, gutes Rentenalter, die jüngeren waren alle auf besseren Schiffen. War ´n Karibik-Kreuzfahrer. Der Kap´tän rief dann die Namen auf, erst mal den Chief-Mate. Der stand dann auf, machte schön artig ´n Diener, und dann haste die ersten Blicke von den Frauen gesehen – uninteressant – interessant – gehakt – oder nicht gehakt. Dann ging die Jagd los auf ihn. Und so ging das dienstgradmäßig weiter... Anschließend mussten die Offiziere alle antreten und die Frauen, die gerne mit einem fotografiert werden wollten, konnten sich von einem der beiden Fotographen an Bord knipsen lassen. Da gab´s dann Bilder mit Widmung...“
Tjard meinte, dass sich die Passagiere dann immer fürchterlich „ins Leben reingestürzt“ hätten, und er erzählte: „...Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Schwule gesehen wie auf ´m Passagierdampfer! Die Stewards und die Köche, dat is dat schwulste Volk wat da überhaupt rumrennt. Auf diesen Musikdampfern jedenfalls. Was wir da manchmal für Dinger erlebt haben!“
Mein Gesprächspartner erzählte dann von einem Chief-Steward, der völlig vernarrt war in einen Matrosen, der wiederum der Schwarm aller Frauen war. Einmal belagerte er den Matrosen regelrecht, während dieser im Mast malte. Als er meinte, die Luft wäre rein und vom Mast stieg, hatte ihm der Steward aber aufgelauert und ihn fast vergewaltigt, so verliebt sei er gewesen. Dem Seemann gelang die Flucht zurück in den Mast. Um wenigstens Feierabend machen zu können, goss er einen halbvollen Eimer weißer Farbe über den braunhäutigen Puertoricaner. „Der sah ´n bisschen scheckig aus und fiel die nächsten drei Tage als Chief-Steward aus...“
Dann kamen wir auf Tjards erstes Handelsschiff zu sprechen: „Das war 1975. Da bin ich auf `n Bulky (einen Bulkcarrier – Massengutfrachter) eingestiegen. In Conakry (Guinea) 90.000 Tonnen Erz geladen, das dauerte acht Stunden. Dann rüber in die Staaten. Das sollte so weiter gehen über ´n halbes Jahr. Anschließend haben wir in Casablanca Phosphat für Brasilien geladen. Erster Hafen: Santos. Wir an die Pier, steht da ´n Spielzeugkran mit so ´m lütten Greifer, wo sie früher bei uns die Gräben mit ausgebuddelt haben. Und wir mit 85.000 Tonnen Phosphat! Erst sollten wir eine Woche liegen, dann zwei, dann sind dat viereinhalb geworden. In Santos! Kein Geld mehr! Und die Ladung erst zur Hälfte gelöscht. War ja nur Teilladung. Wir dann in Paranaguá zwei Wochen gelegen, war bloß ´ne Tagesreise weiter. Von Paranaguá nach Rio. Dort eine Woche, und dann weiter nach Rio Grande do Sul, wo sie uns zwei Wochen zu Ende gelöscht haben...“
Er beschrieb, wie das riesige Schiff daraufhin mehrere Tage lang saubergefegt werden musste, denn als Schüttgut war nun Soja angekündigt: „...Dann kam so `n Bimmelzug mit vier Waggons. Die vier Waggons konnteste in der Luke nicht wiederfinden. So ging das wochenlang weiter... Wir waren letzten Endes viereinhalb Monate lang in Brasilien. Und die Mädchen fuhren von einem Hafen zum anderen hinterher. Durften zwar nicht auf ´m Schiff mitfahren, aber die fuhren mit der Bahn. Die Dockschwalben wurden in den viereinhalb Monaten eben feste Dockschwalben, denn Rasierklingenparties sind ja in Brasilien noch immer ziemlich gefürchtet, ne?“
Wir erinnerten uns, dass es ziemlich unklug war, sich als sogenannter ‚Butterfly‘ zu verhalten, sich wie ein Schmetterling flatternd von Mädchen zu Mädchen zu vergnügen. Tjard erzählte von einem Filipino an Bord: „...Jedenfalls haben sie dem mit der Rasierklinge einmal von unten nach oben und einmal von oben nach unten eins übergezogen. Als sie ihn im Krankenhaus wieder zusammennähten, hatte er 36 Nahtstiche gehabt. Von der Lende übern Brustkasten bis zur Schulter. Dat sind dann so Dinger, wo man ´n bisschen vorsichtiger wird...“
Von Tjards Klönschnack angetörnt fielen uns noch allerlei Geschichten ein, die mit der Heißblütigkeit mancher Sorte Mädchen zusammenhing. Da wurden die narbenverzierten Teufelchen von ‚Schanker Hill‘ genannt. Wir kamen aber auch auf den Trick zu sprechen, Rasierklingen in die Unterkante von Handtäschchen einzunähen. Derlei verheerende Waffen waren beispielsweise an der Küste Singapurs gebräuchlich.
Dann berichtete der Ostfriese von einem Rattendampfer, der mittlerweile mit ‚all hands‘ abgesoffen ist:
„...Jedenfalls, ich steig drauf ein, ging alles holterdiepolter, Cuxhaven raus, nichts überprüft worden, gar nichts! Ein eklig verrotteter Dampfer! Wir haben dann Kartoffeln geladen in Delfzijl, mussten nach Piräus, Milos, Kalamata in Griechenland. Wir dann in einem dieser Häfen eingelaufen. Der Zoll kam, der Hafenarzt, wir wurden überprüft und da stellten die fest, dass im Giftschrank nichts mehr war, keine Opiate, kein Morphium, war total ausgeräumt!“
Den Männern war dann Landgangsverbot erteilt worden, und die Schwarze Gang hatte den Dampfer auf den Kopf gestellt. Aber nichts wurde gefunden.
„Am dritten Tag kamen sie mit ´m Bauwagen an. Die Gangway wurde reingelegt, auf der einen Seite stand der Zoll, auf der anderen ´n Arzt. Wenn du an Land wolltest, erst durch den Bauwagen durch, Klamotten ausziehen. Die wurden vom Zoll untersucht. Der Arzt wühlte inne Haare rum, unter die Arme geguckt, und dann Unterhose runter und bücken und mit dem Gummifinger rin in de Kimm, mal gucken ob da nich´ doch ´n bisschen wat versteckt ist!“
Drei Wochen war der Zossen festgehalten worden. Was mit den Opiaten geschehen war, ist aber nie rausgekommen. Vermutlich waren sie während der langen Liegezeit in der sogenannten Konkursecke in Cuxhaven gezottelt worden...
Dann kamen wir auf jene Kapitäne zu sprechen, die nur ‚voll voraus‘ kannten. Hauruck-Typen, die rücksichtslos durch die Meere brackerten und mit Mensch oder Material kein Erbarmen kannten. Natürlich immer im Sinne der jeweiligen Reederei. Ich entsinne mich genau eines typischen Schiffsunglücks. Ein ob seines draufgängerischen Fahrstils bekannter Kapitän war im Mittelmeer bei Schlechtwetter mit Mann und Maus abgesoffen. Berechtigterweise darf man vermuten, dass das Schiff bei zu schwerem Seegang einfach auseinandergebrochen ist…
Tjard meinte hierzu: „Ja, das kennen die Kapitäne von XYZ doch nur, voll voraus, die laufen ja schon aus, wenn der letzte Container noch am Haken hängt!“
In Seefahrtskreisen waren über viele Reedereien Schnacks im Umlauf, die immer irgendeine typische Seite der Handelsschifffahrt beleuchteten. Etablierte ‚Style‘-Reedereien mussten für affige Image-Histörchen herhalten, andere Kompanien für hartherzig-abgebrühtes Piratenreedertum. Klar, dass es sich hierbei in der Regel um Vorgänge oder Vorfälle handelte, die nicht als Lobhudeleien betrachtet werden konnten.
So wurden mir über die von Tjard erwähnte Reederei verschiedentlich happige Geschichten aufgetischt. Zum Beispiel war ein Frachter dieser Firma mit Eisen von Schweden nach Italien unterwegs und wurde von einem neuen Kapitän geführt. Dieser hatte seinen Ersten gefragt, ob irgendwelche Besonderheiten auf diesem Trip zu beachten seien. Des Ersten Antwort: „Nein!“
Nun wurden diese Zossen sowieso sparsamst bemannt, meist fuhren Kapitän und nur ein Steuermann, die wegen der zusätzlichen Heuerprozente zur Duldung derlei Zustände längst korrumpiert waren. Die Funk-Kommunikation war ebenso Sache der Nautiker, und als Kap Finisterre erreicht worden war, erfuhr der Kapitän endlich während eines Funkgespräches, dass er Vlissingen hätte anlaufen sollen. Man beorderte den Kahn sofort nach Brest, wo der Alte mit Donnerwetter abgelöst wurde. Sein Erster hatte ihm verheimlicht, dass das Schiff jedes Mal Vlissingen anlief, um die Ladungspapiere auszutauschen, welche nun besagten, dass das Eisen aus einem EG-Land stammte und folglich günstigeren Zollbestimmungen unterlag. Perfekter Betrug! Perfektes Mobbing!
Ein anderer Kapitän derselben Kompanie wurde in Europa vom Inspektor zur Rede gestellt, was er sich erlaube und den Dampfer nicht voll belade! Der Pott war von Kanada gekommen und vorschriftsmäßig auf die WNA-Freibordmarke abgeladen, die für die Winterfahrt im Nordatlantik gültig war. Diese, seit 1908 auch in Deutschland gesetzlich vorgeschriebene Lade- und Freibordmarke, an der kontrolliert werden kann, ob ein Schiff überladen ist, erlaubt ein tieferes Abladen in der sogenannten Sommerzone. In tropischen Gewässern ist ein noch größeres Eintauchen des Schiffes genehmigt. Dieser Inspektor nun machte dem korrekt handelnden Kapitän Vorwürfe, weshalb er – in Kanada! – nicht auf Tropenmarke abgeladen habe. Andere Kapitäne würden das schließlich auch hinkriegen, getreu dem Grundsatz, dass gerade die letzten Tonnen Ladung Gewinne bringen. Als der Kapitän ein späteres, ähnlich gelagertes Ansinnen verweigerte, war seine Karriere bei dieser Kompanie beendet.
Es passte! Denn während ich mit meinen Bordkameraden über die nicht selten zwielichtigen Auslegungen von Schiffssicherheit palaverte, ereignete sich ein weiteres Seefahrtsdrama im Nordatlantik. Wir schrieben den 27. November 1981 und erfuhren in den Nachrichten der Deutschen Welle sowie durch den Funkpressedienst vom Untergang der ‚ELMA TRES‘, der von Argentinien gecharterten ehemaligen ‚CORINNA DRESCHER‘. Das 7.800 BRT große Schiff war etwa 200 Seemeilen östlich der Bermudas auf der Reise von Buenos Aires nach Boston in schlechtes Wetter geraten. Als nach Ausfall der Maschine das Fahrzeug quer zur See trieb, wurde es durch übergehende Container der Decksladung entweder leckgeschlagen oder kenterte sogar. Endgültiges war noch nicht zu erfahren, da der einzige Überlebende – der 29-jährige Erste Offizier – nur wenig Klärendes zum Untergang des deutschen Frachters beitragen konnte. Wie durch ein Wunder hatte er 26 Stunden auf einem kieloben treibenden Rettungsboot in der aufgewühlten See überlebt.
Vier Tage später erfuhren wir durch Funk und Presse mehr über den Untergang der ELMA TRES. Wir hörten vom tragischen Ende des philippinischen Leichtmatrosen, der in einer Luftblase unter dem gekenterten Rettungsboot zu überleben versucht hatte. Er war kurz vor seiner Rettung an Entkräftung und wohl auch Angst gestorben. Die Suche nach Überlebenden des im schweren Sturm mit 457 Containern gesunkenen Frachters ging weiter. Lediglich ein Rettungsboot und eine Rettungsinsel ohne Insassen waren gefunden worden. Da die ELMA TRES den Aussagen des geretteten Ersten Offiziers zufolge sehr schnell in die Tiefe gegangen war, bestand wenig Hoffnung, weitere Überlebende zu finden.
Dieser Schiffsuntergang beleuchtete wieder einmal einige wunde Punkte der Kauffahrteischifffahrt. Da waren zunächst die altertümlichen und unzureichenden Rettungsmittel, die ein Überleben zum Lotteriespiel machten. Vor allem bei extrem hohem Seegang wie im Falle der ELMA TRES. Schiffe im fraglichen Seegebiet sprachen von 15 Meter hohen Wellen!
Ferner erschienen vielen von uns die Praktiken fragwürdig, mit denen Reedereien, wie die der ELMA TRES, ihre Schiffe bemannten und fahren ließen. Es war ein offenes Geheimnis, dass der erst vor zwei Jahren - also 1979 - gebaute Frachter mit billigem seemännischem Personal besetzt worden war. Die etwa 15 philippinischen Mannschaftsgrade waren für einen Bruchteil der deutschen Heuer gefahren und nicht unbedingt nach geltenden Bestimmungen ausgebildet.
Aber auch die waghalsige Risikobereitschaft in der Containerfahrt und grundsätzlich bei Deckslasten, die Stabilität des Schiffes betreffend, wurde von uns durchdiskutiert. Auch die Anfälligkeit mancher Maschinenanlagen kam zur Sprache, die bei einer Panne das Schiff zum Spielball der Elemente machen können.
Die Hamburger Reederei war längst wegen ihrer fragwürdigen Tricks mit Heuertarifen, Sozialversicherungsbeiträgen und Verordnungen ins üble Gerede gekommen. Die Gewerkschaft ÖTV durfte laut Urteil des Hamburger Landgerichts die üblen Praktiken mit nachfolgendem Zitat geißeln: „Drescher steigert zu Lasten der Seeleute und der Sicherheit in der internationalen Seeschifffahrt seine Gewinne.“
Im September 1979 hatte ,Der Spiegel‘ einen Artikel unter der Überschrift „Stramm philippinisch – Ein Hamburger Reeder unterläuft das geltende Seemannsgesetz“ gebracht. Bis auf einige unwesentliche Absätze folgt hier die Abschrift:
„Am Nachmittag des 12. Juli dampfte der Hamburger Frachter ‚STEFAN DRESCHER‘ elbabwärts aus seinem Heimathafen. An Bord des 8.100-Tonners: ausnahmslos deutsche Seeleute. - Zwei Tage später, als die STEFAN DRESCHER nach einem Zwischenstopp in Rotterdam auf große Fahrt in die Karibik ging, war die deutsche Besatzung auf sieben Mann geschrumpft: Die niederen Dienste an Bord versahen 16 Filipinos.“
„Für den Hamburger Reeder ... bringt der Personalwechsel bares Geld. Im Schnitt verdient ein deutscher Matrose nach Tarif runde 2.500 Mark im Monat. Ausländer dagegen bringen es allenfalls auf ein Fünftel der deutschen Heuer.“
„Dass die billigen Ausländer nicht gleich in Hamburg an Bord gegangen waren, hat seinen guten Grund: Für Schiffe, die unter deutscher Flagge fahren, verlangen die Seeberufsgenossenschaften von den Seeleuten einen Matrosenbrief. Und der fehlte den Filipinos, die in einer Rotterdamer Pension auf ihren Einsatz gewartet hatten.“
„Der Besatzungstausch in Rotterdam war keine Ausnahme im Geschäftsgebaren der hanseatischen ... Reederei. ...Im Herbst letzten Jahres (1978) lief die STEFAN DRESCHER den Hamburger Hafen direkt an, zum Besatzungstausch in einem anderen europäischen Hafen blieb keine Zeit. Kurzerhand ließ die Reederei daher die Besatzung während der Fahrt auswechseln. Vor Cuxhaven, so ermittelten Späher der Gewerkschaft ÖTV, brachte ein Schlepper deutsche Seeleute längsseits und holte die Filipinos von Bord.“
„Ungewöhnlich ist die Personalpolitik der ... Reederei auch zu Land. In einer internen Dienstanweisung wurde ...festgelegt, dass ‚Mitarbeiter der Reederei nicht Mitglied einer Gewerkschaft sein dürfen‘... Denn (so ein Vertreter der Reederei) bei Matrosen, ‚die in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen, versuchen wir selbstverständlich immer, niedrigstmögliche Konditionen abzumachen.‘ Und dies gehe nun mal am besten mit Leuten, ‚die nicht in der Gewerkschaft sind‘...“
Seinerzeit kamen wir zu dem Schluss, dass der Schiffsuntergang der ELMA TRES alias CORINNA DRESCHER nur ein Weilchen die zuständigen Gemüter, vor allem die der Medien erhitzen wird. Irgendwann wird eine der üblichen Wischiwaschi-Seeamtsverhand-lungen über die Bühne gehen. Man wird Experten bemühen, die zu feige sind, Missstände als Missstände zu bezeichnen – und im Übrigen wird alles beim Alten bleiben.
Wie dann die Seeamtsverhandlung wirklich ausgegangen ist, habe ich nach zwei Jahrzehnten nicht mehr in Erinnerung. Der Untergang war tragisch genug. Ob aber die wirklich Schuldigen ihr Fett wegbekommen haben, wage ich immer noch zu bezweifeln!
Seefahrt ist halt vor allem Business. ,Profit first‘ – und nicht ‚Safety first‘ hieß die Parole! Leider standen sich da sogar alte Fahrensleute selbst im Wege, indem sie in ihrem Bangen um die Karriere alles bejahten und mitmachten, was dem Profit diente, selbst auf Kosten der eigenen Sicherheit. Uns Seeleuten war klar, dass nur ein prosperierender Reedereibetrieb unsere Arbeitsplätze erhalten konnte, dass dem Unternehmer gesundes Gewinnstreben nicht als ausbeuterische Halsabschneiderei angekreidet werden sollte. Aber Einsparungen nur auf Kosten der Fahrensleute und nur mit miesen Tricks und nur mit eiskalt kalkulierenden, sich selbst überschätzenden Karrieremachern als Vorgesetzten, das konnte nicht die angestrebte Lösung eines Problems sein, das uns alle anging!
Wenn beispielsweise Laschgangs die Ladung auf Schiffen so nachlässig absicherten und vertäuten, dass man die Bezeichnung ‚Laschgang‘ auf die lasche Arbeit dieser Leute gemünzt sehen könnte, dann kam es einem bitter hoch. Zumal diese Männer meist von ehemaligen Fahrensleuten beaufsichtigt wurden und somit genau hätten wissen müssen, was sie Besatzung und Schiff antaten. Ein belgischer Nautiker, der in Antwerpen das Laschen schwerer Ladungsstücke beaufsichtigte, sagte mir, dass er seinen Männern oft dieses Argument an den Kopf werfen musste: „Ihr fahrt nach Hause, aber die Seeleute müssen damit durch schlechtestes Wetter!“
Man denke nur an die schweren ‚Coils‘ (Rollen aus Eisen- oder Stahlblech, die gut 30 Tonnen wiegen können und sich auf kleinstem Stauraum zu ungeheueren Gewichtsmassen addieren), die auch auf der ‚MÜNCHEN‘ transportiert worden waren. Viele Seeleute hegen offen den Verdacht, dass die Laschings an diesen ‚Coils‘ nicht hielten und so die tödliche Schlagseite verursacht wurde. Laut amtlicher Feststellung des Seeamtes Bremerhaven aber ging die MÜNCHEN durch einen schweren Seeschlag unter.
Am 4. Dezember 1981 lagen wir mit der MICHAELA *) wieder am Deepwater-Terminal in Greenwich. Proviant und Ausrüstung mussten übernommen werden. Da war jede Hand von Nutzen. An Land zu gehen wäre unfair, irgendwie unkameradschaftlich gewesen. Auch neue Leute kamen. Ablöser für den Ersten, den Chief, den Zweiten Halabi, den Koch und zwei Mann von Deck. Auch mein ostfriesischer Kumpel Ubbo *) wurde abgelöst.
Tage später klönte ich ein Weilchen mit dem Ersten Offizier Lindemann *), den ich von früheren Seefahrtstagen kannte. Er kam richtig in Fahrt als er von seinem letzten Schiff sprach, einem ‚Contergan-Zossen‘, wie der unschöne Ausdruck für die Ro-Ro-Schiffe lautete, die vorne ein Minimum an Aufbauten und Lebensraum für die Besatzung bereithielten: Schulbeispiel für den verächtlich am Seemann vorbeieilenden Fortschritt! Lindemann schilderte mir die Machenschaften des Kapitäns dieses Wurstwagens, der zwischen Rotem Meer und Italien Liniendienst verrichtete.
Alle drei Wochen habe es etwa 3.500 Mark Laschgeld gegeben, wovon der Alte 1.500 an die Mannschaft verteilte, also 2.000 Mark selbst einsteckte. Zuzüglich gab es einen Bonus, das übliche Anerkennungsgeld – oder Schmiergeld – an den Kapitän, mit dem einige Charterfirmen und Reedereien ihre Zufriedenheit ausdrückten – oder erkauften. In diesem Bonus waren auch die Unkosten für die unzähligen Zigarettenstangen enthalten, mit denen üblicherweise während der Suezpassage geschmiert wurde und wird, was dem Verbindungsstück zwischen den Weltmeeren den Namen ‚Bakschisch-Kanal‘ eingebracht hat. Der Bonus selbst sei dadurch allerdings kaum geschmälert worden, versicherte Lindemann: „Der Alte hat also gut und gerne alle drei Wochen dreitausend Mark kassiert!“
Der dickste Hund sei aber folgender Sachverhalt gewesen: Auf dem Ro-Ro-Schiff waren die Containerstellplätze an Deck mit maximal 20 Tonnen belastbar, schwerere Boxen durften also nicht an Deck gestaut werden. Als der Pott aus einem Rotmeerhafen wieder Richtung Suezkanal auslief, habe der Erste endlich die vom Kapitän zurückgehaltenen Papiere durchsehen können und dabei festgestellt, dass mehrfach zwei Container mit je 15 Tonnen Gewicht übereinandergestellt worden waren, pro Stellplatz also das Limit von 20 Tonnen um 10 Tonnen überschritten worden war.
„Da müssen Sie eben aufpassen!“ habe ihn der Kapitän angefaucht. „Und auf einer der nächsten Reisen fand ich heraus, dass der Alte für die Überbelastung der Stellplätze Dollars kassiert hatte“, erzählte der Erste weiter. „Aber nicht nur das hat mich vor Wut zittern lassen. Da hatte der Alte in Italien Parmaschinken vom Schiffshändler bringen lassen. Und als wir endlich mal etwas davon auf der Back sehen wollten, sagte der Koch, dass der Alte den Schinken mit nach Hause genommen hatte...“
Schade, dass materielle Gier aus manchen Mitmenschen unsympathische Charaktere machte. Schade, dass das Empfinden für Redlichkeit und Fairness beim Anblick schmuddeliger Dollarscheine so rasch verloren ging. Schade auch, dass die meisten dieser gestreiften Halbgötter nie auf die Idee kamen, wenigstens einen Teil des sogenannten Bonusgeldes an die gesamte Besatzung zu verteilen. Denn, hatte nicht jedes Besatzungsmitglied mit seinem Wissen und Können für das Gelingen einer Reise beigetragen...?
- nur noch als ebook bei neobooks und vielen großen Händlern und als kindle-e-book bei amazon neu in 3 Teilen direkt vom Autor Mario Covi eingestellt
Schiffsbilder
Informationen zu den maritimen Büchern des Webmasters finden Sie hier:
zur gelben Zeitzeugen-Bücher-Reihe des Webmasters:
© Jürgen Ruszkowski

zur gelben Zeitzeugen-Bücher-Reihe des Webmasters:
© Jürgen Ruszkowski
Maritime books in German language: fates of international sailors
Los libros marítimos en el idioma alemán: los destinos de marineros internacionales:
zu meiner maritimen Bücher-Seite
navigare necesse est!
Maritime books in German language: fates of international sailors
Los libros marítimos en el idioma alemán: los destinos de marineros internacionales:
|
Meine Postadresse / my adress / Los orden-dirección y la información extensa:
Jürgen Ruszkowski, Nagelshof 25,
D-22559 Hamburg-Rissen,
Telefon: 040-18 09 09 48 - Anrufbeantworter nach 30 Sekunden -
Fax: 040 - 18 09 09 54
Bestellungen am einfachsten unter Angabe Ihrer Anschrift per e-mail
|

|
weitere websites des Webmasters:
Elbdorf Rissen
Diese website existiert seit dem 6.06.2005 - last update - Letzte Änderung 17.06.2018
Jürgen Ruszkowski © Jürgen Ruszkowski © Jürgen Ruszkowski
|

