 |
Datenschutzerklärung auf der Indexseite
Band 56 - Immanuel Hülsen
Band 56
|

Immanuel Hülsen
|
Band 56
in der Buchreihe "Zeitzeugen des Alltags"
Immanuel Hülsen
Schiffsingenieur, Bergungstaucher. Flieger
|
Band 56
Immanuel Hülsen
Schiffsingenieur, Bergungstaucher

nicht mehr lieferbar
Inhalt:
Vorwort des Herausgebers
Der Autor
Rückblicke und Erinnerungen aus einem erlebnisreichen Leben
Herkunft und Kindheit
Schulzeit
Frankesche Stiftung
Wieder in Wustrow
Wittower Posthaus
Schlosserlehrling
Der Traum vom Fliegen
Seefahrt
Krieg
Kriegs-Seefahrt
Luftwaffenpilot
Kriegsgefangenschaft
Flucht aus der Kriegsgefangenschaft
Zurück im Nachkriegsdeutschland
Hamburg 1946
Beschwerliche Reise nach Hiddensee
Hiddensee
Erste Begegnung mit Tauchern
Uranbergbau – Wismut AG – Aue
Seefahrtschule Wustrow
DDR-Hochseefischerei
Flucht in den Westen
Kiel
Taucher
Bergungstaucher in Schweden
Bergung der Schiffe des ‚Seedienst Ostpreußen’
Reise nach Senegal
Tauchabenteuer vor Senegal
Wieder Bergungstaucher in Schweden
3. Ingenieur auf Dampfer „HOLNIS“
Unterwasserarbeiten in der Türkei
Istanbul
Taucherarbeiten in Acajutla / EI Salvador
Hochseefischerei
Studium an der Staatlichen Schiffsingenieur-Schule in Flensburg
Seefahrt Seefahrt um 1960
Stellung an Land
Steckenpferd Fliegerei
341 Seiten
* * *
In diesem Band 56 können Sie wieder Rückblicke und Erinnerungen eines ehemaligen Seemanns über sein erlebnisreiches Leben kennen lernen. Der frühere Bergungstaucher, Seemaschinist und Schiffsingenieur erzählt von Kindheit und Jugend an anschaulich aus seinem Leben, über seine Schulzeit und Berufsausbildung, sein frühes Interesse am Fliegen, vom Beginn seiner Fahrten als Ing-Assistent ab 1938 auf einem Hamburg-Süd-Dampfer und auf weiteren Schiffen, über seine Kriegs- und Nachkriegserlebnisse. Als Bergungstaucher, Seemaschinist und Schiffsingenieur lernte er unterschiedliche Bereiche auf und unter dem Wasser kennen. Der Leser bekommt einen sehr guten Einblick in die Arbeits- und Erlebniswelt der damaligen Seefahrt und des Bergungsgeschäfts nach dem Kriege. Als berufener Zeitzeuge erzählt er vom entbehrungsreichen, aber auch schönen Leben in längst vergangenen Jahrzehnten. Seine Leidenschaft galt lebenslang der Fliegerei.
Leseproben:
Ich selbst wurde am 1. Januar 1921 geboren, war also am Sterbetag meines Vaters gerade vier 4 Jahre alt. Die einzige Erinnerung an diese Zeit: Eine weinende Mutter, die ihre kleine Tochter, geboren am 13. März 1924, auf dem Arm trägt, meinen Bruder, geboren am 21. Februar 1923, an der Hand hält, und ich stehe vor ihr und weiß nicht, was passiert ist. Ich höre sie noch sagen: „Nun sind wir allein, Papa kommt nicht wieder.“...
...Es war Frühjahr 1926, als ich eingeschult wurde. Meine Mutter hatte mich nett angezogen. Vor der Schule standen mehrere Frauen, die ebenfalls ihre Kinder zur Schule brachten. Vor dem Schulportal standen einige Herren: unsere Lehrer. Wir hatten den Klassenraum betreten, einen verhältnismäßig großen Raum, in dem drei Reihen Tische standen mit groben Holzbänken davor. Jede Reihe hatte sechs Tische, jeder Tisch hatte Platz für zwei Schüler. Meine Reihe stand an der Wand, es war die Reihe der Schulanfänger. Das zweite Schuljahr hatte die Mittelreihe, und das dritte Schuljahr saß an der Fensterfront. Da alle Reihen voll besetzt waren, so hatte der Lehrer drei Schuljahre in einer Klasse zu unterrichten...
Leseproben:
Seefahrt
Schon während meiner Lehrzeit hatte ich an die Seefahrt gedacht. Ein Cousin von mir, Herbert Paukert, fuhr damals als 2. Offizier bei einer Reederei. An ihn hatte ich mal einen Brief geschrieben (nachdem ich wieder mal mit meiner Lehre nicht zufrieden war) und darum gebeten, ob er mir behilflich sein könnte, ein Schiff zu bekommen usw., usw. Die damalige Antwort war für mich niederschmetternd gewesen. In kurzen Worten teilte er mir damals mit, dass ich erst meine Lehre beenden solle, und danach könnten wir weitersehen.
Nachdem ich nun Geselle geworden war, hatte ich die Voraussetzung geschaffen, die technische Seite bei der Seefahrt näher zu betrachten. Viel Zeit konnte ich nicht verstreichen lassen, und so teilte ich meiner Mutter mit, dass ich mich entschlossen hätte, in den nächsten Tagen nach Hamburg zu fahren, um mir ein Schiff zu suchen.
Sie hatte keine Einwände, so meinte sie nur, wie denn meine Freundin – Hanna – das sehen würde? Hanna war meine Jugendliebe. Als Lehrling in der Schlosserei trugen wir ein Arbeitszeug, wie es heute als „Blue Jeans“ fast nur noch getragen wird. Immer, wenn ich damals Hanna traf, schämte ich mich wegen dieses Anzuges. Aber da waren noch einige andere hübsche Mädchen, so die Lissi, die alles daran setzte, Hanna auszustechen, und Regina, meine anschmiegsame Tanzstundenpartnerin, und dann – Geraldine –, die zu mir sagte, ich solle sie „als Frau behandeln und nehmen“, wobei ich den tieferen Sinn ihrer Worte erst viel später begriff. Wie wir so über Freunde und Freundinnen reden, da sieht mich meine Mutter so komisch an und druckst so rum, und als ich frage, was sie hat, da sagt sie etwas, an das ich in meinem Leben sehr oft gedacht habe: „Wenn Du uns jetzt verlässt und zur See gehst, dann werden Dinge auf dich zukommen, die du alleine entscheiden musst. Frauen werden deinen Weg kreuzen und du wirst nicht immer wissen, wie du dich zu entscheiden hast. Ich möchte dir mit auf deinen Weg geben: Verschwende dich, wo immer es sich lohnt, aber verplempere dich nie!“ So sprach meine Mutter zu mir. Aber so, wie ich die damalige Äußerung meiner Freundin Geraldine nicht verstand, so habe ich den Rat meiner Mutter erst sehr viel später begriffen.
Ich fuhr dann noch Ende Januar 1939 nach Hamburg, wo ich schon am 01. Februar 1939 mein erstes Schiff, die „TUCUMAN“ von der Reederei ›Hamburg Süd‹ bekam. Als Ingenieur-Assistent wurde ich gemustert und war von nun an Messemitglied und in der Maschine war ich „Assi für alles“. Ich wurde dem 3. Ingenieur beigegeben und hatte die so genannte „Hundewache“ zu gehen, mittags von 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr und nachts von 00:00 Uhr bis 04:00 Uhr. Mittschiffs hatte ich eine eigene kleine Kammer, in der ich mich recht wohl fühlte. Nach dem Frühstück, immer sehr reichhaltig, war noch Arbeitszeit, wo viel auch an Deck gearbeitet wurde und die Dampfwinden überholt wurden.
Von diversen Erzählungen an Bord erfuhr ich, dass sehr häufig in Südamerika Besatzungsmitglieder vom Landgang nicht wieder an Bord zurück kamen und an Land blieben. Diese Leute verließen sehr schnell die Hafenregion, um sich den Zugriffen der örtlichen Polizei zu entziehen. Und so kam mir der Gedanke, es diesen „Deserteuren“ gleichzutun. Schon während der Überfahrt arbeitete ich mir meinen Fluchtplan genauestens aus. Nun gab es zu der Zeit auf den deutschen Schiffen auch ›politische Aufpasser‹ und ein solcher war der Koch unseres Schiffes! Alle, die neu angemustert waren, wurden ausführlich belehrt, dass ein Desertieren von Bord zwecklos sei, und das Schiff sehr eng von der Geheimpolizei überwacht würde. Die Rückbringquote der Flüchtigen läge über 90%, und die Strafen, die auf Desertion in Deutschland nach Rückkehr ausgesprochen würden, wären grausam. Und so hat der Koch es tatsächlich fertig gebracht, soviel Ängste zu verbreiten, dass ich später in den verschiedenen brasilianischen Hafenstädten von einer Flucht Abstand nahm. Das ärgert mich noch heute, dass ich damals nicht bei meinem Vorhaben blieb, nur weil ich – durch den Koch – die Hosen voll hatte!
Die Reederei legte Wert darauf, dass auch die Ing. Ass. In der Freizeit Uniform tragen würden. Ich besaß aber keine und wurde daher mehrmals in der Messe darauf angesprochen, mir bei ›Brendler‹ in Hamburg eine entsprechende Bekleidung zu besorgen.
Bei der Ankunft in Hamburg wurde die Heuer für die Zeit an Bord – inkl. Überstunden – ausbezahlt. Ich bekam eine Summe, wie ich sie nicht erwartet hatte, nämlich 412 Mark. Als ich das Geld in den Händen hatte, musste ich daran denken: Noch eine Reise und ich würde mir das DKW-Motorrad kaufen können. Mit dem Geld kaufte ich mir all die Sachen, die ich an Bord benötigte, und als ich alles zusammen hatte, da musste ich an die Firma ›Brendler‹ fast 130 Mark zahlen.
Dann traf ich den Messesteward, und gemeinsam gingen wir zur Reeperbahn und landeten letztlich in dem Etablissement „REGINA“, wo wir beide ganz groß auftraten. Eine sehr nette ›Dame‹ nahm sich meiner in rührendster Weise an, und nach zwei Tagen der Freude hatte mein gesamtes Geld einen anderen Eigentümer gefunden. Dann konnte ich gehen. Da das Schiff an den Dalben im Strom lag, musste ich mit dem Jollenführer an Bord fahren, der nahm mich aber nicht mit, da ich nicht bezahlen konnte. Mein Onkel gab mir dann ein kleines Darlehen von 10 Mark. An Bord wagte ich keinem aus der Messe ins Gesicht zu sehen, ich schämte mich sehr und kündigte. Auch die gut gemeinten Worte des 3. Ing., dass das kein Beinbruch sei und jeder Lehrgeld bezahlen würde, nützten nichts – ich kündigte und verließ noch am gleichen Tag die „TUCUMAN“.
Das war Lehrgeld und nun wusste ich, was meine Mutter gemeint hatte – verschwende dich, wo immer es sich lohnt, aber VERPLEMPERE dich nie! Nach allen Regeln der Kunst hatte ich mich – verplempert.
Mein zweites Schiff war die „TRAUTENFELS“ der Hansa-Reederei aus Bremen. Mein Freund aus Stralsund, Georg Vogel, wurde von mir informiert, dass noch eine zweite Assi-Stelle auf dem Schiff frei wäre. Er sagte zu, und wir fuhren gemeinsam nach Indien. Es war eine sehr anstrengende Reise. Unvorstellbare Hitze im Roten Meer; in der Maschine bis zu 70 Grad und dann die Monsunzeit, Sturm und himmelhoher Seegang, der Windhuzen umknickte und ein Rettungsboot zerschlug.
Krieg
Beim Kohlebunkern in La Valetta auf Malta hieß es schon, ob wir wohl die Reise überstehen würden, da es mit Sicherheit bald Krieg geben würde. Am 29.08.1939 waren wir wieder in Hamburg, und zwei Tage später begann der 2. Weltkrieg!
Die Schiffsleitung hatte schon bei der Heimfahrt, im Roten Meer, die Nachricht erhalten, dass die derzeitige politische Lage das Schlimmste befürchten ließe, und wir, komme was da wolle, so schnell wie irgend möglich das Reichsgebiet erreichen sollten. Nach dieser Nachricht wurde das Äußerste aus der Maschine rausgeholt, und wir liefen im Schnitt zwei Knoten mehr. Mein Wachingenieur hatte ausgerechnet, dass wir nur dann die Chance hätten, bei der tollen Fahrt, nach Deutschland zu kommen, wenn wir in der Biskaya kein schlechtes Wetter bekommen würden! Wir kamen durch die Straße von Gibraltar, wo eine Menge Kriegsschiffe lag und konnten danach problemlos die Biskaya durchqueren. Als wir den Ärmelkanal hinter uns hatten, kam zum ersten Mal ein Trimmer aus dem Bunker und meldete, dass die Kohlen fast alle wären, worauf der Leitende Ingenieur die Fahrt drosseln ließ, so dass wir buchstäblich mit dem letzten Rest an Kohlenstaub Hamburg erreichten!
Nun lagen wir also auf Warteposition in Hamburg. Abmustern durften wir vorerst nicht, da die große Menge an Seeschiffen eine zusätzliche Organisationsarbeit verlangte. Auf den Schiffen arbeiteten ja viele Fachleute, wie Nautiker, Ingenieure mit den Assistenten und einige mehr.
Nach einigen Tagen kamen zwei Herren an Bord, und das Bordpersonal bekam, entsprechend der Ausbildung, andere Arbeitsaufgaben zugeteilt. Und so wurden wir, zwei Ing. Assistenten, in das Flugzeugwerk Ernst Heinkel, nach Rostock-Marienehe verpflichtet. Gleichzeitig wurde uns gesagt, dass die Verpflichtung zeitlich begrenzt sei und wir jederzeit wieder zur Seefahrt rückberufen werden könnten. Diese Maßnahmen waren zwangsweise nötig, da ja vorerst die Schiffe nicht eingesetzt werden konnten, da ja durch den Krieg eine vollkommen andere Situation eingetreten war. Es verwunderte mich aber schon, mit welcher Schnelligkeit außergewöhnliche Situationen damals geregelt wurden. Bei der Enteignung des Besitzes meiner Mutter waren die damaligen Behörden ja genauso schnell vorgegangen.
Es waren eben diktatorische Maßnahmen, gegen die man sich nicht wehren konnte.
Am 15.09.1939 meldeten wir uns, wie befohlen, bei der neuen Arbeitsstelle, dem Flugzeugwerk ›Ernst Heinkel‹ an, wo wir als „Monteure“ den Bordmonteuren in der Einfliegerei beigegeben wurden, genau genommen eine Laufjungentätigkeit mit tollem Namen und annehmbarer Bezahlung...
Leseprobe:
...Am 28.06.1940 bekam ich die Nachricht, dass ich mich – unverzüglich – am 02.07.1940 als Ing. Assistent auf dem Dampfer „IDA BLUMENTHAL“ in Hamburg einzufinden hätte! Kündigen bei dem Werk ging schnell, und die anderen Formalitäten wurden noch am 28.06. erledigt, und so hatten Thea und ich noch einige Tage für uns.
Am 02.07. brachte sie mich zum Frühzug nach Hamburg. Ich könnte über diesen Abschied eine Menge schreiben. Wozu noch viele Worte – mir sagte sie nur noch, dass sie unendlich traurig wäre und sie die Zeit mit mir nie vergessen würde! Der Zug fuhr – Rostock lag hinter mir, aber an die Zeit mit Thea habe ich noch sehr lange gedacht. Zwei Briefe bekam ich noch. Wiedergesehen habe ich sie nicht mehr!
Am 2. Juli 1940 kam ich noch am Vormittag in Hamburg an, wo ich zu meiner Dienststelle ging. Hier wurde ich belehrt, dass ich in Zukunft unter Reichsdienstflagge fahren würde. Alle zukünftigen Versetzungen kämen ebenfalls nur von der Dienststelle. Dann erhielt ich noch einige Informationen und verabschiedete mich, um an Bord der „IDA BLUMENTHAL“ zu gehen. Es war ein Dampfer von ca. 2.500 Tonnen, der in Friedenszeit das Mittelmeer, sowie Nord- und Ostsee befahren hatte. Ein gemütliches Schiff, auf dem man zwei Wachen ging. Der Chief sagte gleich zu mir, dass ich mit ihm die Wache 06-12:00 Uhr gehen würde, desgleichen von 18 bis 24:00 Uhr. Bereits im April 1940 hatte die Wehrmacht Dänemark und Norwegen besetzt, und so war für das Schiff schon eine Tour vorgesehen. Wir befuhren die Ostsee und kamen nach Reval, dann nach Dänemark, wo wir verschiedene Häfen anliefen. Von dort in den Oslofjord und dann wieder zurück nach Kiel. Und das ging so bis zum 20.10.1940, da war leider mein Aufenthalt auf der „IDA BLUMENTHAL“ beendet.
Ich bekam eine Versetzung nach Stavanger in Norwegen, wo die Wehrmacht bei der Besetzung des Landes einen großen Dampfer erbeutet hatte, die „SALMONPOOL“. Dieses Schiff erhielt den Namen „PUTZIG“ und sollte nun von Norwegen mit eigener Kraft nach Hamburg fahren. In aller Eile wurde die Besatzung zusammengesucht, was nicht vollkommen gelang und wir mit der halben Maschinenbesatzung den Dampfer seeklar machen mussten. Das dauerte natürlich seine Zeit, aber es gelang uns, und wir dampften Richtung Hamburg ab. In der Werft wurde dieses Schiff umgebaut, es wurden große Podeste am Vor- und Achterschiff installiert, auf denen Schnellfeuerkanonen ihren Platz bekamen. Der ganze Umbau dauerte etwa 10 Wochen. Als alles fertig war, kam die vollständige Zivilbesatzung an Bord, und unter der Leitung eines Oberbootsmannes kamen 18 Marinesoldaten als Bedienung der Geschütze. Die Fracht bestand aus Baumaterial, Maschinen und über 2.000 Tonnen Zement und einiges mehr. Die erste Tour ging wieder nach Norwegen. Wir kamen gut an und auch wieder zurück. Mit etwa gleicher Ladung sollte es wieder nach Norwegen gehen, diesmal nach Trondheim. Auch diese Fahrt wurde überstanden. Wir hatten zwar einen Fliegerangriff, aber die Begleitboote und die eigene Flak schossen, was aus den Rohren raus ging, und so kamen wir mit Verzögerung in Trondheim an. Hier lernte ich auch eine hübsche Norwegerin – Signe – kennen, die ich nach Deutschland mitnehmen wollte, was aber am eisernen NEIN meiner Mutter scheiterte.
Die 3. Tour ging voll in die Hose. An einer offenen Seestrecke vor der norwegischen Küste gab es zum dritten Mal Fliegeralarm. Aus dem Dunst – kaum zu sehen – kamen mehrere Torpedoflieger an.
Ich sehe sie noch heute, wie sie so eben über der Wasserfläche anfliegen und sich nicht um Tod und Teufel scheren, das starke Flakfeuer missachtend den Torpedo einwerfen. Einer geht am Schiff vorbei. Ein Zweiter trifft mittschiffs und der dritte Torpedo explodiert in der Ruderanlage. Aus, Feierabend, das Schiff sinkt! Es ist kalt und sehr windig. Wir stehen alle an Deck und warten, dass ein Marine-Begleitschiff in unsere Nähe kommt, keiner kann sich im Moment entschließen, in das eisige Wasser zu springen. Das Schiff hat jetzt eine Schlagseite von etwa 30 Grad nach Steuerbord, und die Decksladung (schwere Straßenbaumaschinen, Feldbahnloren und weiteres schweres Baumaterial) kommt, wie von Geisterhand geschoben, ins Rutschen und durchbricht, teilweise, die Reeling und versinkt im Meer. Dann kommt ein Vorpostenboot (umgerüsteter, ehemaliger Fischdampfer) mit Volldampf auf uns zu, kann aber wegen unserer Schlagseite nicht bei uns längsseits gehen, und wir werden aufgefordert, in die zwei Rettungsboote zu gehen, die von den Matrosen sofort nach dem Angriff zu Wasser gelassen wurden. Das eine Boot ist durch den feindlichen Beschuss total zersiebt und bis oben voll Wasser. Das zweite Boot macht auch Wasser, aber man kann es lenzen. Es sitzen schon sehr viele von unserer Besatzung im Boot, das dann die paar Meter zu dem Vorpostenboot fährt. Die sind also erst mal in Sicherheit. Aber was ist mit den anderen, wie werden die Marinesoldaten, die, bis es nicht mehr ging, an den Flakwaffen ausharrten gerettet?
Es blieb uns nur der Sprung in das eisige Wasser übrig. Zwar hatte man einige Rettungsflöße ins Wasser geworfen, trotzdem blieb uns der Sprung ins Wasser nicht erspart. Ich selbst schwamm sofort nach meinem Sprung auf das Vorpostenboot zu, bekam einen Rettungsring zu fassen, der noch eine Leinenverbindung zum Marineschiff hatte und wurde so an das Schiff gezogen. Durch die Kälte war es mir nicht möglich, mit eigener Kraft an Bord zu kommen. Nur durch die Hilfe von zwei starken Matrosen kam ich an Bord. Ich war gerettet.
Leider waren von den Leuten, die gerade in der Maschine Wache hatten, keiner gerettet worden. Der Treffer saß ja mittschiffs und da gab es kein Entrinnen.
Die Verluste der zivilen Maschinenbesatzungen waren erheblich und kaum ersetzbar. Zwar wurden immer mehr Ausländer verpflichtet, trotzdem war nach dem damaligen Motto – ‚Achtung, Feind hört mit!’ – nur eine begrenzte Zahl von ausländischem „Maschinen-Fachpersonal“ auf Schiffen unter Reichsdienstflagge anzutreffen.
Nachdem ich aus dem Bestand des Schiffes mit dem Nötigsten eingekleidet worden war und der Frost aus meinem Körper wich, sah die Welt schon wieder etwas anders aus. Der norwegische Hafen, wo wir anlandeten, ist mir entfallen. Die stark Unterkühlten kamen für einige Tage in ein Krankenhaus, wo eine genaue Untersuchung erfolgte. Hier besuchte mich auch Signe aus Trondheim für einige Tage, und als ich gerade dabei war, mich an diesen neuen Zustand zu gewöhnen, da schlug das Schicksal ganz gewaltig zu, und ich bekam eine sofortige Versetzung auf ein Schiff „SAMOS“, das in einem italienischen Hafen lag. Wo genau, ist mir entfallen!
An dieses Schiff habe ich kaum eine positive oder negative Erinnerung. Dann wurde ein Konvoi von 14 Schiffen zusammengestellt, und unter dem Schutz der italienischen Marine verließen wir im April 1941 bei Nacht den Hafen von Neapel. Beladen mit Kriegsmaterial für das hart kämpfende Afrika-Corps. Nun hatten die Engländer einen starken Stützpunkt auf der Insel Malta, wo unter anderem auch U-Boote stationiert waren.
Es war gegen 23:00 Uhr als es einen gewaltigen Detonationsknall gab. Es war die Wache des 1. Ingenieurs, dessen Assistent ich war. Mein Chief ließ sich sowieso nur sehr kurzzeitig in der Maschine sehen und überließ mir sehr häufig eigenverantwortlich die Anlage zu fahren. So waren neben mir nur noch ein Reiniger und im Heizraum drei Heizer sowie ein Kohlentrimmer auf Wache.
Im Geleitzug der 14 Schiffe waren wir die Nummer 12. Etwas achterlich, nach Backbord versetzt, liefen wir – ca. 400 Meter – hinter der Nr. 11. Es war eine gewaltige Explosion, die bei uns in der Maschine noch etlichen Schaden verursachte, den wir aber beheben konnten. So waren z. B. drei Wasserstandsgläser geplatzt, einige Flanschen waren undicht geworden, und es waren in der Maschine fast alle Glühbirnen ausgefallen. Die Flurplatten waren alle aus ihren Sitzen gerissen. Dann kam der Chief mit einer hellen Notlampe runter und beauftragte zwei Mann aus dem Heizraum, dass als erste Maßnahme die Flurplatten wieder in die richtigen Lagen gebracht wurden. Ich selbst hatte die Wasserstandsgläser ausgewechselt und war dabei, bei zwei Flanschen die Schrauben anzuziehen, als es wieder zweimal gewaltig krachte. Diesmal hatten zwei größere Schiffe aus Italien dran glauben müssen, die beide brennend versanken. In der ersten Nacht hatten sie uns drei Schiffe aus dem Konvoi geschossen, und am drauffolgenden Tag wurden durch Luftangriffe noch zwei weitere Schiffe so schwer beschädigt, dass sie die Geschwindigkeit des Konvois nicht halten konnten und den Befehl erhielten, auf eigene Faust zu versuchen, den vorgesehenen Hafen zu erreichen.
Die Rücktour lief dramatisch ab. Wir wurden aus der Luft laufend von Jägern beschossen, und ein Flugzeugtyp, der auch sehr schnell war, versuchte uns mit aller Gewalt mit Bomben zu treffen. Wir wurden auch durch eigene Jäger zeitweise beschützt, dann verschwanden die Engländer, um gleich wieder zu erscheinen, wenn unsere Maschinen heimflogen. Als wir endlich Neapel erreichten, sah das Schiff fürchterlich aus und musste zu Reparaturarbeiten einen Werftbetrieb aufsuchen.
In der Hoffnung, mir nun in Neapel einige schöne Tage machen zu können, erhielt ich Tage später die Nachricht, in einer Textfolge, die mir inzwischen schon bekannt war, dass ich ein neues Bordkommando anzutreten hätte und zwar auf dem, zur damaligen Zeit, sehr modernen Dampfer „MARITZA“.
Ich musste nach Griechenland, wo das Schiff in Piräus lag. Es hieß, die Ladung rolle schon an, aber keiner (bis auf die verantwortlichen Herren) wusste genau Bescheid. Und eines Tages war es dann soweit, sie rollten an, die Ungetüme in jeder Größe – Panzer über Panzer – ich weiß nicht mehr, wie groß die Einheit war, der Chef der Einheit war ein Oberst, und alle Offiziere waren in ihren schwarzen Uniformen gut anzusehen. Auch die übrigen Mannschaften machten einen guten Eindruck, und alle hatten hohe Auszeichnungen, mehrere trugen Ritterkreuze.
Ich hatte eine schöne große Kammer, in der zwei Kojen waren. Ich bekam Einquartierung, zu mir kam ein Oberfeldwebel – Ritterkreuzträger – und von ihm erfuhr ich, dass die Einheit zur Insel Kreta versetzt werde, um die hart kämpfenden Fallschirmjäger zu unterstützen! Es dauerte noch einige Zeit, bis alles unter Dach und Fach war. Dann ging es ab, Richtung Kreta! Von nun an verlief alles unter einer enormen Anspannung. Die Maschine lief mit einer Leistung von 100% und der 1. Ing. jammerte: „Oh Gott, wenn das man gut geht – diese Belastung meiner Maschine, man muss sie doch schonend fahren.“ Und so hörte ich ihn oft mit sich selbst reden. Die Dampfmaschine mit einer Abdampfturbine hielt die Belastung spielend durch, und das Schiff lief mit über 14 Knoten Stunde um Stunde.
Der Engländer setzte alles dran, um uns zu kriegen. Wir wurden von Flugzeugen mehrmals angegriffen, aber immer wurden sie abgewehrt, dank unserer Marinesoldaten, die hervorragend zielten und schossen.
Als es dämmerte, gab es mit einem Mal Alarm, der länger anhielt als sonst. Gleichzeitig änderte das Schiff laufend den Kurs. Von hart Backbord auf hart Steuerbord und das laufend. Damit versuchte der Kapitän, den Angriffen der feindlichen Schnellboote zu entgehen, was ihm auch gelang. Sie hatten bestimmt nicht mit unserer Feuerkraft gerechnet, die von den drei Booten, die uns angriffen, zwei Boote so trafen, dass sie abdrehen mussten und von weiteren Angriffen absahen! Nur das dritte Boot ließ nicht nach und versuchte immer wieder, sich in eine günstige Schussposition zu bringen. Insgesamt schoss es auf uns drei Torpedos ab, die aber alle ihr Ziel verfehlten.
Den genauen Tag unserer Ankunft in Kreta kann ich nicht mehr benennen. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie die große Bucht hieß (Suda-Bucht ?) in die wir einliefen. Genau sehe ich aber das von der Wehrmacht zerschossene und auf Grund liegende englische Kriegsschiff in dieser Bucht liegen. Da uns keine Kräne zur Verfügung standen, musste mit unserem eigenen Schwergutgeschirr gearbeitet werden. „MARITZA“ besaß zwei Schwergutbäume mit einer Tragkraft von je 100 Tonnen, und somit waren wir in der Lage, alle Panzer selbständig an Land zu setzen. Das alles geschah unter dem Schutz der Wehrmacht, und es gelang ohne Zwischenfall, die gesamte Ladung zu löschen. Wir waren alle heilfroh, dass wir keine Verluste hatten.
Dann ging es nach Griechenland zurück, weil es hieß, wir sollten noch eine weitere Tour nach Kreta machen. In Piräus angekommen, übernahmen wir über 300 Italiener, die sich im Kampf in Griechenland und Albanien als untauglich erwiesen hatten und daraufhin wie Feinde behandelt wurden. Dann waren wir wieder in Italien, diesmal aber nicht in Neapel, sondern auf der östlichen Seite, in Bari, wo wir eine Menge großer Kisten, über 100 Autos und dergleichen mehr an Bord nahmen. Als alle dachten, na diesmal sieht es ja direkt human aus, da wurden wir in einer „Nacht- und Nebelaktion“ wieder nach Neapel beordert, wo wir – abgeschirmt vor fremden Blicken – eine Höllenladung an Bord nahmen. Abgefüllt in 20-Liter-Wehrmachtsbehälter übernahmen wir für die Rommelarmee 8.000 Behälter mit Benzin, unterteilt in Normalkraftstoff für die Autos und hoch verbleites Benzin für die Flugzeuge. Da wurde es jedem von uns doch ein bisschen mulmig. Und dann kam noch ein Sonderbefehl. In einem Geleitzug richtet sich die Geschwindigkeit immer nach dem langsamsten Schiff, das für schnellere Schiffe eine zusätzliche Gefahr bedeutet. Daher bekamen wir die Order, nachdem das Benzin an Bord war, sofort auszulaufen, um mit der höchstmöglichen Fahrt den Hafen Benghasi in Libyen zu erreichen.
Und dann ging es los, gerade als es Nacht wurde. Mit Höchstfahrt liefen wir durch die schwarzdunkle Nacht, und unser Schnitt lag über 15 Knoten. Die Maschine lief wie ein Uhrwerk und ohne die geringste Beanstandung. Da die Kessel ölbefeuert waren, brauchte man nur, um die Maschinenleistung zu erhöhen, die Brennstoffpumpen höher einzustellen, und schon erhöhte sich die Leistung. Im Falle einer kohlenbefeuerten Kesselanlage hätte die Erhöhung der Maschinenleistung nur durch die körperliche Mehrarbeit der Heizer erfolgen können. So kamen wir in Sicht der libyschen Küste noch mal vor die Kamera eines britischen Aufklärungsflugzeuges, und nun war den Gegnern bekannt, dass unser Durchbruch durch die feindliche Überwachungs- und Kontrollzone gelungen war. Genau, als wir an der Pier in Benghasi festgemacht hatten, erfolgte ein Luftangriff, der zum Ziel hatte, uns zu treffen. Die Feuerkraft des zu der Zeit in Benghasi liegenden deutsch-italienischen Militärs war so stark, dass wir ohne Schaden an die Löscharbeiten gehen konnten. Täglich war mehrmals Fliegeralarm und es mussten dann die Entladungsarbeiten (= Löschen) sofort eingestellt werden. Wenn ich heute daran zurückdenke, was passiert wäre, wenn nur eine kleine Bombe die Benzinladung getroffen hätte – es hätte furchtbare Folgen gehabt!
Trotz der mehrmaligen täglichen Unterbrechungen durch Fliegeralarm wurden am 10. Tag nach unserer Ankunft in Benghasi die Löscharbeiten als beendet gemeldet.
Noch in dieser Nacht wurde die „MARITZA“ seeklar gemacht, und am frühen Morgen verließen wir den Hafen. Wir waren höchstens 30 Minuten gefahren, als es einen ohrenbetäubenden Knall gab – wir waren auf eine Mine gefahren. Die Gewalt der Minenexplosion war so enorm, dass ich den Eindruck hatte, das Schiff hebe sich aus dem Wasser. Es brach in Höhe des Kesselraumes auseinander. Das ging alles so schnell, und ehe man sich versah, waren alle, die diese Explosion überlebt hatten, im Wasser und warteten, dass Rettungsschiffe aus dem Hafen kommen würden. Neben mir schwamm ein Heizer, der, wie ich, Freiwache hatte und an Deck stand, als die Explosion erfolgte. Er hatte keine Schwimmweste angelegt und war am Ende seiner Kräfte, da er kaum schwimmen konnte. Ich sah, wie er sich abmühte, den Kopf über Wasser zu halten. Dann löste ich meine Schwimmweste, um sie ihm zu geben. Ungefähr 30 Minuten später kam ein Motorboot aus dem Hafen und rettete alle, die noch im Wasser schwammen, auch den Heizer, dem meine Schwimmweste bestimmt das Leben gerettet hatte.
Nun saßen wir in Benghasi fest, und es war vollkommen unklar, was mit uns geschehen sollte. Langsam erfuhren wir, dass in der Nacht vor unserem Auslaufen zwei Schnellboote der Briten Minen vor den Hafen gelegt hätten. Man hätte sie genau beobachtet – trotzdem, man hatte uns einfach fahren lassen! Diesmal war das Wasser warm gewesen, aber wenn ich an die Kälte in Norwegen zurückdenke, dann wären alle damals erfroren und ertrunken, wenn sie so lange im Wasser hätten zubringen müssen, wie wir jetzt. Wir hatten nur unser Leben retten können und hatten alles verloren. Man brachte uns notdürftig in einem Schulgebäude unter und versuchte uns mit Militärsachen einzukleiden. Verpflegt wurden wir Schiffbrüchigen bei einer italienischen Infanterieeinheit, die sich sehr viel Mühe gab, uns so gut sie konnte, zufrieden zu stellen. Nun saßen wir in Benghasi und warteten auf unsere Rückführung. Es machten sogar Gerüchte die Runde, dass wir eventuell auf italienischen Schiffen eingesetzt werden könnten. Aber das waren, wie gesagt, alles nur Gerüchte. Leider hatten wir bei dem Minentreffer doch einige Besatzungsmitglieder verloren, und es waren auch mehrere Leute verwundet worden.
Nach etwa einer Woche hieß es, dass das deutsche Handelsschiff „KIEPFELS“ (oder „KYPFELS“ ? - ist mir leider nicht mehr genau in Erinnerung) in Tripolis erwartet würde, und wenn alles gut ginge, sollten wir mit dem Schiff nach Italien mitgenommen werden. Nun saßen wir aber zu der Zeit in Benghasi fest und die Frage war, wie kommen wir nach Tripolis? Es waren immerhin über 1.000 km, die uns trennten. Aber das wurde sehr schnell und einfach gelöst, indem ein Transportflugzeug der italienischen Luftwaffe beordert wurde, uns nach Tripolis zu bringen. Nach einigen Tagen kam eine Maschine, etwa so groß wie eine ›Ju 52‹ nach Benghasi (der Typ hieß „Savoia Marchetti“), und wir wurden zum Flugplatz gefahren und nahmen im Laderaum des Flugzeuges Platz. Es gab keine Bänke oder Stühle; wir saßen zwischen der Ladung auf dem blanken Boden. Es war entsetzlich unbequem, und man sagte uns, dass der Flug sehr lange dauern würde! In den Bordwänden waren größere Öffnungen, in denen Maschinengewehre installiert waren. Zwei Soldaten hockten den ganzen Flug über hinter den Gewehren und hielten Ausschau auf feindliche Flugzeuge. Wenn ich ehrlich bin, war ich sehr erleichtert, als es hieß, dass Tripolis in Sicht sei und der Landeanflug in Kürze beginnen würde. Wir waren über die große Sirte geflogen, ein direkter Kurs, in etwa 2.000 Meter Höhe. Die Soldaten hatten Fallschirme angelegt, für uns gab es aber keine. Als dann das Flugzeug gelandet war und auf seinem Platz abgestellt wurde, da sah man in sehr bleiche Gesichter, und jeder, aber auch jeder, war froh, diesen Flug heil überstanden zu haben.
Die Crew der „MARITZA“ wurde mit einem Bus abgeholt und in ein Hotel gebracht, da das Schiff noch nicht angekommen war. Nach vier Tagen war die „KYPFELS“ in der Nacht eingelaufen, und im Laufe des Tages erhielten wir die Order, dass wir bei Dunkelheit auf das Schiff gehen sollten. Das taten wir dann auch und mussten sehr schnell feststellen, dass wir nicht die einzigen Rückkehrer waren. Bisher war ja alles gut verlaufen, und ich hatte nur noch den Wunsch, heil in Italien anzukommen. Alles verlief einwandfrei. Das Schiff verließ am Abend den Hafen von Tripolis und lief mit Höchstfahrt, unter dauerndem Kurswechsel, Richtung Italien. Es war ein noch verhältnismäßig neues Schiff der Reederei ›Hansa‹ aus Bremen und hatte bei Kriegsbeginn einen deutschen Hafen nicht mehr erreicht, so dass es nun im Mittelmeer operierte. Mühelos fuhr das Schiff 17 Knoten, und es war ein sehr beruhigendes Gefühl, dass diese Geschwindigkeit ein zusätzlicher Schutz gegen feindliche U-Bootsangriffe war. Und so ging diese Überfahrt, von Tripolis nach Neapel an einem frühen Morgen mit einem herrlichen Sonnenaufgang zu Ende.
Einige Wenige, darunter auch ich, wurden sehr kurzfristig in ein Hotel gebracht, und wir bekamen die Möglichkeit, uns von oben bis unten neu einzukleiden, denn wir hatten ja buchstäblich alles verloren. Damit wir nicht lange überlegen mussten, hatte man uns Gedankenstützen gegeben, auf denen alles vermerkt war, was ein Mann so alles benötigt. Ich genoss es, einkaufen zu können, und andere übernahmen die Bezahlung. Es waren drei herrliche Tage.
Dann erhielt ich die Nachricht, dass ich auf Grund meiner diversen Einsätze für einen Erholungsurlaub in Sorrent vorgeschlagen sei, und ich noch am gleichen Tag erfahren würde, welches Hotel mich aufnehmen sollte. Meine Dienststelle in Neapel arbeitete wirklich sehr schnell, und bereits zwei Stunden später erfuhr ich, dass für mich das Hotel „Tramontana“ vorgesehen sei. So fuhr ich also – in bester und modernster Garderobe – nach Sorrent und ich fühlte mich rund um wohl. Die Fahrt ging um den Vesuv herum und war schön und interessant. Nun weiß ich nicht mehr genau, ob ich bis Sorrent durchfahren konnte – mir ist, als hätte ich auch noch eine Straßenbahn benützt. Egal, ich bin jedenfalls gut im Hotel angekommen. Man nahm mir das Gepäck ab und ein Hotelboy brachte mich sogar in mein Zimmer. Ich kann nicht beschreiben, wie ich mich damals fühlte – mehrmals in den letzten Monaten gerade noch mal davongekommen und jetzt dieses wunderschöne Hotel, die Ruhe, der übergroße, blühende Garten mit einem hohen Apfelsinenbaum, an dem sehr viele Früchte hingen. Es dauerte seine Zeit, bis ich das alles verdaut hatte. Aber ich hatte auch Ärger. Man hatte mir einen Tisch zugewiesen, an dem ich der einzige Zivilist war. Neben zwei Offizieren der Marine saß noch ein beleibter, ca. 40 Jahre alter Oberleutnant am Tisch, der mich gleich aufs Korn nahm. Er wollte, nachdem ich mich vorgestellt hatte, wissen, wieso ich ein Zivilist wäre, was ich in einem solchen Hotel überhaupt zu suchen hätte, und er erdreistete sich sogar, mir zu sagen, dass in einem Kampf, wo unsere tapfer kämpfenden Soldaten für Führer, Volk und Vaterland ihr Leben ließen, es noch junge Zivilisten gäbe, die mit großer Wahrscheinlichkeit den Heldenkampf unseres Volkes noch nicht begriffen hätten. Ich habe ihm dann meine Dienststelle genannt und ihm geraten, sich seine Neugier dort befriedigen zu lassen. Dort würde man ihm auch sicherlich bestätigen, welche Arbeit, die nicht ungefährlich sei, ich Tag für Tag für Führer, Volk und Vaterland verrichten müsse usw., usw. Übrigens möchte ich mit gleicher Waffe antworten. Da es Ihnen nichts ausmachte, mich vor den beiden anderen Herren zu beleidigen, so sei mir gestattet, Anstoß an Ihrer „Blanken Brust“ zu nehmen. Damit ich nicht weiter Ihr Missfallen nähre, werde ich um einen anderen Platz bitten. Dann stand ich auf, verabschiedete mich von den beiden Marineoffizieren und verschwand. So also fing mein Urlaub im Hotel Tramontana in Sorrent an.
Am vierten Tag, als ich ein bisschen zur Ruhe gekommen war, schlenderte ich so durch die Straßen, als mir eine Gruppe Schülerinnen entgegen kam. Sie lachten und waren fröhlich. Ich blieb stehen und machte Platz, damit die Mädchen an mir vorbei konnten. Eine von ihnen blieb kurz stehen, sah mich an und sagte, dass ich wohl kein Italiener sei. Da ich sie nicht verstanden hatte, sprach sie mich in einem sehr holprigen Deutsch an, und als sie begriffen hatte, dass ich Deutscher sei, da riefen ihre Mitschülerinnen, und sie lief denen hinterher. Am nächsten Tag ging ich zur selben Zeit den gleichen Weg, und da kam sie an, und wir gingen zusammen weiter, bis zu ihrem Haus. Das wurde eine fröhliche Urlaubsfreundschaft. Ihr Name war ›Angelina‹, 17 Jahre alt und ein nettes, liebes Mädchen. Dann wurde ich zweimal zum Abendessen eingeladen und bekam ausführlich Unterricht im Spaghettiessen. Ohne Löffel natürlich! Bei dem zweiten Abendessen war diesmal der Vater von Angelina mit dabei. Als italienischer Marineoffizier wollte er, im Laufe des Gespräches von mir wissen, was ich vom Konvoischutz der italienischen Marine halte. Die Fangfrage von ihm verstand ich damals nicht, und so erzählte ich ihm meine Eindrücke wahrheitsgemäß. Dabei schnitt die italienische Marine nach meinen persönlichen Erfahrungen nicht immer positiv ab. Angelinas Vater erregte sich und sprach mich in seiner Sprache an, die sehr heftig wurde. Dann stand er auf und deutete auf die Tür, was soviel hieß, dass ich mit sofortiger Wirkung sein Haus verlassen sollte! Seine Tochter, der die Entwicklung unseres Dialogs sehr peinlich war, wollte mich noch zur Tür begleiten, wurde aber von ihrem Vater – in Befehlsform – daran gehindert. Trotz allem hatte ich mit Angelina zwei nette Urlaubswochen, so fuhren wir zweimal gemeinsam nach Neapel und machten eine Schiffsfahrt nach der Insel Capri – aber ihr Haus war nun für mich verschlossen. Sie wollte zu Anfang unserer – harmlosen – Beziehung wissen, welche Haarfarbe ich lieber hätte? „Blondes Haar mag ich lieber als schwarzes Haar“, hatte ich geantwortet. Was tat sie daraufhin? Sie ließ sich einige blonde Strähnen von einem Frisör in ihr schwarzes Haar reinarbeiten, was hinterher nicht besonders gut aussah.
So vergingen diese netten Tage in einem, von mir aus, Schwester-Bruder-Verhältnis leider viel zu früh und – Ende August 1941 – wurde ich nach Hamburg zurück versetzt. Es war wie ein grausamer Schock für mich gewesen. Eben noch in dem, auch zur damaligen Zeit, lebensfrohen Süditalien und jetzt zurück ins diktatorische, kalte Deutschland.
Ab dem 04.09.1941 war ich als Ing. Assistent auf dem Torpedo-Klarmachschiff MS „FRIEDA HORN“ gemustert. Das Schiff lag in Hamburg in der Werft und wurde total umgebaut. Es wurde ein reines Werkstattschiff und erhielt die Funktion, U-Boote, bevor sie zum Einsatz kamen, auszurüsten und zwar mit allem, was ein Boot auf langer Feindfahrt benötigte. Es war auch vorgesehen, dass die Besatzungen der U-Boote auf der „FRIEDA HORN“ während der Erprobungsfahrt wohnen sollten, was zur Folge hatte, dass eine Menge zusätzlicher Kammern hergestellt wurden. In der Maschine wurden noch zusätzlich drei große Dieselaggregate, zur Stromversorgung, eingebaut und die gesamte maschinen-technische Anlage wurde von zivilen Schiffsingenieuren und den Assistenten gefahren. Wohlgemerkt, nur die eigentliche Antriebsanlage des Schiffes wurde von Zivilisten gefahren!
Als alles fertig war, und die Werft das Schiff „Klar zum Einsatz“ meldete, da machten wir die Maschine seeklar und warteten auf den Auslaufbefehl. Trotz strengster Geheimhaltung wusste jeder, dass das Schiff nach Gotenhafen, dem polnischen Hafen ›Gdynia‹ (so hieß der Hafen aber auch vor 1933) verlegt werden sollte. Irgendwann war es soweit, wir verließen Hamburg in Richtung Gotenhafen, den wir auch ohne Zwischenfälle erreichten. Nachdem wir einen festen Liegeplatz hatten, ging es auch gleich voll zur Sache. Gleichzeitig lagen immer zwei U-Boote an der „FRIEDA HORN“, wobei auf dem Schiff immer eine nervöse Unruhe herrschte, die schon durch den laufenden Mannschaftswechsel der Bootsbesatzungen entstand. Der zivile Bordbetrieb lief sehr ruhig ab. Da das Schiff ja nur an der Pier lag, so entfiel dann auch die Seewache, und wir hatten eine ganz normale Tagesarbeit, wie in den Landbetrieben üblich. Die vier Ingenieure wechselten sich in der nächtlichen Maschinenwache gleichmäßig ab, wobei sie in ihren Kammern bleiben konnten und nur ›sofort zur Verfügung‹ stehen mussten, wenn ein „Notfall“ dies erforderlich machen würde. Ihre Assistenten gingen, ebenfalls abwechselnd, Maschinen-Nachtwache, die wir aber im Maschinenraum verbringen mussten. In den fünf Monaten meiner Bordzeit ist nicht ein einziger „Notfall“ im Maschinenraum vorgekommen, so dass keiner der Ingenieure einmal zur nächtlichen Hilfeleistung in den Maschinenraum gebeten wurde! Alles in allem war meine Bordzeit ein ausgesprochen ›ruhiger Job‹, der manchmal auch eintönig war.
Eines Tages begegnete ich an Bord einem Maschinenmaat (Unteroffizier) und erkannte ihn sofort wieder. Es war Hans, der mit mir 1935 bei der Maschinenfabrik C.A. Beug in Stralsund als Lehrling angefangen war, seine Lehre aber ohne Abschluss 1938 aufgegeben hatte, um zur Marine zu gehen. Man kann sich vorstellen, dass dieses Wiedersehen entsprechend gefeiert wurde. Während der Lehrzeit war ›Hans‹ mit Vorsicht zu genießen gewesen, da er ein großer Zyniker war und seine spöttischen und häufig beleidigenden Äußerungen uns, die wir mit ihm gemeinsam lernten, oft sehr hart trafen. Damals sah ich auch einige Male seine kleine Schwester auf dem Werksgelände, wie sie ihrem großen Bruder das Abendessen brachte, da im Sommer fast nur im Akkord gearbeitet wurde und die Lehrlinge des 2., 3. und 4. Lehrjahres bis 20:00 Uhr, und häufig noch etwas länger, mitarbeiten mussten. Dieses kleine Mädchen wurde meine zweite Frau. Aber nicht im Traum hätte ich damals eine solche Entwicklung für möglich gehalten.
Wenn ein U-Boot mit der festen Besatzung die Bauwerft verlassen konnte, kam es zur weiteren Ausrüstung, bis hin zum Torpedo-Probeschießen zu einem Ausrüstungsschiff, wie es die „FRIEDA HORN“ eins war. Diese Zeit der Erprobung dauerte etwa eine Woche. Dann ging es ab, Richtung Kriegseinsatz.
Da ich verhältnismäßig viel Freizeit hatte, z. B. nach der Nachtwache hatte ich einen kompletten Tag frei, so konnte ich auch viele Touren in die Umgebung unternehmen. Für einen Ausweis benötigte ich ein Bild und kam in dieser Absicht, mich fotografieren zu lassen, in ein Fotogeschäft. Da ein großer Andrang herrschte und ich ja genügend Zeit hatte, konnte ich eine junge Frau beobachten, die in dem Laden bediente und durch ihre Figur und Ausstrahlung allgemein auffiel. Als sich der Laden langsam leerte, nahm sie mein Anliegen entgegen, gab aber auf meine weiteren Fragen keine Antwort. Wie das bei jungen Männern so ist, ich ließ nicht locker, und so entstand zwischen der Polin ›Danuta‹ und mir, dem Deutschen, eine sehr tiefe Freundschaft, die für beide Seiten mit großer Gefahr verbunden war! Es war damals bei höchster Strafe verboten, mit Polen zu sprechen. In öffentlichen Verkehrsmitteln war ihre Sprache verboten, und mir sind aus der damaligen Zeit einige Urteile bekannt, die in ihrer Härte unmenschlich waren. Nun gut, ich war von ihrer Familie aufgenommen worden und war bereit, im Falle des Falles, jede Bestrafung zu ertragen, als ihr Bruder verhaftet wurde und für mich die Gefahr bestand, von der „Gestapo“ verhaftet zu werden. Um meine damalige Situation heute zu begreifen, erkenne ich klar und deutlich, dass ich in Danuta verliebt war und die eventuellen Konsequenzen einfach nicht erkennen konnte. Nach der Verhaftung ihres Bruders ließ ich mich einige Tage nicht sehen. Dann wurde das Wetter sehr schlecht, es regnete, was vom Himmel wollte, und es stürmte sehr stark. An einem Tag, ich hatte keine Nachtwache und somit frei, ging ich in das Haus, wo Danuta wohnte. Im Laufe des Gespräches wurden wir uns einig, dass wir aus reinen Sicherheitsgründen den Kontakt zueinander vorerst abbrechen müssten. Und so geschah es denn auch schon durch die unbewusste Hilfe, die per Brief von der Kriegsmarinedienststelle aus Hamburg kam.
Mir wurde mitgeteilt, dass ich auf Grund von Personalmangel für den Besuch einer Ingenieurschule vorgesehen sei und ich mich in Hamburg zu melden habe! In Erinnerung an meine damalige, nicht ungefährliche Situation muss ich heute bekennen, dass das für mich einen Rettungsanker bedeutete, der mir eigene Entscheidungen – sehr willkommen – abnahm. Mein Ltd. Ing. gab mir noch mit Datum 24. Februar 1942 ein sehr gutes Zeugnis mit. Ich machte eine Verabschiedungstour, besuchte kurz meine Freundin, und dann war das Intermezzo ›Gotenhafen‹ beendet.
In Hamburg meldete ich mich auf der „Kriegsmarinedienststelle“, holte mir weitere Instruktionen ab, bekam eine Freistellungsbescheinigung, damit ich nicht vom Militär eingezogen werden konnte und war entlassen. Nun war es ja klar, dass ich nur für ein Studium auf einer Schiffsingenieurschule freigestellt worden war. Das war aber so in meiner Freistellungsbescheinigung nicht formuliert worden, was mir später ein Disziplinarverfahren ersparte.
Ohne Zweifel war ich jetzt dabei, einen sehr großen Fehler zu machen, indem ich nach Wismar ging und mich dort für das Studienfach „Luftfahrttechnik“ an der Ingenieurschule der Seestadt Wismar eintragen ließ.
Schon bald hatte ich in meiner Lehrzeit bemerkt, dass meine Mutter Recht hatte, als sie mich auf eine Aufbauschule bringen wollte, ich dies aber ablehnte, da in meinen Erinnerungen immer noch die grausame Zeit der Franckeschen Stiftungen vorherrschte. Während ich auf einer Aufbauschule das Abitur hätte machen können, hatte ich jetzt – nur – eine Volksschulbildung. Dass ich damit nicht meinen Wunschtraum erreichen würde, einmal Berufspilot zu werden, wurde mir schon bald, nach Beginn meiner Schlosserlehre, klar.
Der Zufall kam mir in einer Zeitschriftenanzeige zu Hilfe. Da warb ein Fernlehrinstitut in Konstanz für Weiterbildung unter anderem auch für die Mittlere Reife. Ich habe dann an das Institut geschrieben, einen Vertrag gemacht, den meine Mutter mit Freuden unterschrieb und bekam dann in regelmäßigen Abständen Lehrbriefe mit Aufgaben, die ich dann nach Konstanz schickte, wo sie korrigiert an mich zurückgeschickt wurden. Anfang 1938 bekam ich einen Brief und eine Urkunde, jetzt bestätigte mir das Lehrinstitut mit Siegel und Unterschrift, dass ich nunmehr die Mittlere Reife hätte, schrieben mir aber gleichzeitig, dass ich nun mich zur Prüfung an einer staatlichen Schule anmelden könne, um dort meine – anerkannte – Mittlere Reife zu erwerben! So also, mit Wissen ausgerüstet, meldete ich mich im Sekretariat der Ing.-Schule in Wismar an, um einen Tag später zu erfahren, dass ich auf alle Fälle ein Vorsemester machen müsste. Noch wäre genügend Zeit gewesen, die Zelte in Wismar abzubrechen, um mein Studium auf einer Schiffsingenieur-Schule zu beginnen. Nun hatte ich auch keine Lust mehr, mich wieder an einer anderen Schule zu bewerben, und so blieb ich in Wismar hängen, obwohl mir absolut klar war, dass meine Handlungsweise ein Fehler war, der sich irgendwie rächen würde. Dann erfuhr ich noch, dass die Schiffsingenieurschulen damals sogar begabte Volksschüler zuließen, und ein Vorsemester war dort nicht vorgesehen. Trotzdem, ich blieb in Wismar. Ich hätte also schon damals mein Studium mit einem Patent abschließen können, wenn ich den richtigen Weg gegangen wäre.
In der Schule hatte ich überhaupt keine Probleme, und ich merkte sehr schnell, dass ich im Fernstudium sehr viel gelernt hatte.
Über das Sekretariat bekam ich einige Adressen, die an Studenten vermieteten. Ich entschied mich für eine Bleibe, die nicht allzu weit von der Schule entfernt war, eine nette ältere Wirtin hatte und relativ preisgünstig war. Nachdem ich meine Sachen eingeräumt hatte, überlegte ich, was zu tun sei, als die Luftschutzsirenen zu heulen anfingen. Es dunkelte schon, und ich fragte meine Wirtin, ob im Haus ein Luftschutzkeller vorhanden sei. Es gab einen, den ich etwas später betrat. Eine Menge Leute saßen bereits auf Bänken und Stühlen, und ich wusste im Moment nicht, wo ich abbleiben sollte. Dann sah ich in dem spärlichen Licht eine jüngere Frau, in deren Nähe ich mich nieder ließ. Zur damaligen Zeit war ich weit davon entfernt, ein Kind von Traurigkeit zu sein, und so dauerte es nicht lange, bis ich mit der jungen Dame ins Gespräch kam und wir uns nett und angeregt unterhielten. Als dann der Alarm beendet war und alle Leute den Keller verließen, da war meine nette junge Dame leider in der Dunkelheit verschwunden. Na gut, dachte ich, es werden ja sicherlich noch öfter Treffen im Luftschutzbunker stattfinden und irgendwie werde ich sie schon mal wieder treffen, und das dauerte gar nicht lange. Eines Tages stand eine junge Frau in der Küche und es war genau die Person, die ich zwei Tage vorher im Keller angetroffen hatte. Dann kam noch meine Wirtin dazu, und sie sagte, dass es bis jetzt noch keine Gelegenheit gegeben hätte, uns bekannt zu machen und das täte sie jetzt. Da wir Wand an Wand wohnten, war es nur eine kurze Zeit, bis wir uns näher kamen. Und wir kamen uns sehr nah. Meine neue Bekannte hieß Friedel. Sie arbeitete in einem rüstungstechnischen Betrieb im Büro. Es wurde Sommer und wir Studenten hatten nette Mädels, mit denen wir an den Strand fuhren und sehr oft, absolut privat, ausgelassen tanzten. Meine Freundin wurde immer anhänglicher, und dann kam sie mit dem Wunsch nach einem Kind, und als wir uns etwa drei Monate kannten, wollte sie partout ein Kind von mir. Ich setzte alles dran, dies zu verhindern, und sie tat genau das Gegenteil. Sie beteuerte mir, nie mit irgendwelchen Forderungen zu kommen, aber ich blieb bis zum Ende des Semesters, so gut wie eben möglich, beim Nein! Es änderte diese Situation für mich auch etwas, als meine Schwester Waltraud sich zu einem Studium der Metallographie und Werkstoffkunde an der Ingenieurschule eintragen ließ, um auf diesem Gebiet Ingenieurin zu werden. Als im Mai 1945 der Krieg beendet war, war meine Schwester im letzten Semester. Ihr Semesterleiter nahm sich das Leben, was sie psychologisch überaus stark belastete. Meine Schwester besuchte, nach Kriegsende, eine Ingenieurschule in Berlin, wo sie ihr Studium als Ingenieurin erfolgreich abschloss!
Ende Juli 1942 endete mein Vorsemester, und ich muss gestehen, mir war meine derzeitige Situation ausgesprochen peinlich, noch dazu ich genau wusste, dass ich von meiner Dienststelle ja für einen andern Studienzweig vorgesehen war.
Am 25. Juli 1942 bekam ich mein Semesterzeugnis, was gut ausfiel. Wenn ich heute an meine Zeit in Wismar zurückdenke, so muss ich gestehen, dass ich die wenigste Zeit in meine Lehrbücher schaute, anderen Verlockungen aber gerne nachging.
Ehe ich mich versah, wurde ich nach Hamburg befohlen! Der Briefstil war ganz anders als früher, wenn sie mich von einem Höllenjob zum nächsten Einsatz schickten. Da in dem Schreiben das Wort ›unverzüglich‹ zweimal enthalten war, brach ich alle bestehenden Verbindungen in kürzester Zeit ab, und da mein Wohnungsmietverhältnis sowieso nur für ein Semester vorgesehen war, brauchte ich nicht zu kündigen. Als nächstes packte ich meine Sachen, ging zum Bahnhof, wo ich mir für den – „übernächsten Tag“ – eine Fahrkarte nach Hamburg kaufte und verlebte die zwei Tage mit Friedel in Saus und Braus.
In Erinnerung an meine leider kurze Studienzeit in Wismar war sie doch - trotz Krieg - fröhlich und wir verübten viele Streiche, wobei unser größter Gag die nächtliche Demontage eines Bauernwagens (dieser stand auf dem großen Marktplatz) war, um ihn wieder komplett auf dem Balkon des Rathauses zusammen zu stellen (heute ein harmloser Ulk, damals eine sehr gefährliche Untat).
In Hamburg angekommen, scheute ich mich, zu meiner Dienststelle zu gehen und ließ noch zwei Tage verstreichen ehe ich dort erschien. Der Empfang, den man mir bereitete, war alles andere als freundlich. So wurde ich immer weitergereicht, hörte von jedem die gleichen maßregelnden Worte und landete letztlich beim obersten Boss, der mir erklärte, dass mein eigenmächtiges Handeln noch ein Nachspiel haben würde und ich mir somit die größten Chancen versaut hätte. Und in dieser Art, wo nur einer sprach und ich zuhören musste, ging es noch eine Zeit weiter. Er bescheinigte mir aber gleichzeitig meinen Einsatzwillen und dass ich jedes Kommando bisher angenommen hätte. Dann entließ er mich, und ich hatte jetzt den gleichen Weg zu gehen – diesmal nur umgekehrt – von oben nach unten, wobei alle wissen wollten, was der Chef gesagt hätte, usw., usw. Der letzte im Reigen, mein Sachbearbeiter, teilte mir mit, dass mein nächstes Bordkommando auf dem Turbinenschiff „KARPFANGER“ erfolgen würde. Mit diesem Schiff, voll beladen bis unter die Lukendeckel und einer gewaltigen Deckslast versehen, sollte es nach Nordnorwegen gehen. Dort kamen wir aber leider nicht an, weil uns wiederum zwei Torpedos, die von Flugzeugen auf uns abgefeuert wurden, so hart trafen, dass das große Schiff in kürzester Zeit sank!
Dann der übliche „Ablauf“ – Rettung aus dem Wasser, Krankenhaus, Neueinkleidung, Reservepapiere, Marschbefehl etc., etc. Am 29.9.1942 wurde ich offiziell vom TS „KARPFANGER“ abgemustert und wurde sofort, von meiner bisherigen Dienststelle für die Einberufung zur Kriegsmarine freigestellt! Wie sagt man? Das war also die Rache meiner ehemaligen Dienststelle. Nie und nimmer hätten sie mich sonst für die Kriegsmarine freigestellt. Bei dem eigenen Personalmangel auf den Schiffen, die unter „Reichsdienstflagge“ fuhren, wäre ich auf keinen Fall freigestellt worden. Ich hatte mit der Ing. Schule in Wismar also einen großen Fehler gemacht.
In kurzen Sätzen werde ich versuchen meine Kriegsmarinezeit zu schildern. Am 13.10.1942 wurde ich zur Marine nach Kiel eingezogen. Daselbst eine 14tägige Wartezeit, und danach Abkommandierung nach Deutsch-Krone (Hinterpommern) zu einer Rekrutenausbildung – Dauer etwa 14 Tage. Diese Rekrutenausbildung wurde kurzfristig unterbrochen, um in Libau (Lettland) fortgesetzt zu werden. Nach der Ausbildung verlegte die gesamte S.ST.A, so nannte sich eine ›Schiffsstammabteilung‹ nach Pillau (Ostpreußen). Diesen Umzug machte ich noch mit und wurde danach zur A.ST.K. (Ausbildungsstammkompanie) nach Leba in Hinterpommern abkommandiert. Nach genau vier Wochen konnte ich zum ersten Mal in Urlaub fahren. Nach dem Kurzurlaub lag schon meine Versetzung zur Marineschule in Neustrelitz vor. Der Motorenlehrgang dauerte acht Wochen, und danach erfolgte eine Abschlussprüfung, die ich mit „gut“ bestand. Danach wurde ich zur 3. S.ST.A. nach Kiel-Friedrichsort versetzt, wo ich noch einige Informationsgespräche (vier Teilnehmer) hatte, und danach war ich Offiziersanwärter! Ja, so ging es damals vonstatten.
Was ich nie geglaubt hätte, ich bekam eine Versetzung als Heizer auf einen Minensucher mit einer Wasserverdrängung von 650 Tonnen. Da wollte ich auf gar keinen Fall hin, und von jetzt an setzte ich Himmel und Hölle in Bewegung, um von diesem Kommando freizukommen...
Leseprobe:
...So ging ich zu meiner damaligen Marinedienststelle, die im Krieg dafür zu sorgen hatte, dass die Frachtschiffe, sofern benötigt, unter „Reichsdienstflagge“ fuhren. Das Personal solcher Schiffe, war der Kriegsmarine gleichgestellt und hatte immer sehr gefährliche Aufgaben zu erledigen, wie zum Beispiel die Versorgung des Afrikacorps mit Kraftstoff und Munition usw.
Nun saßen in der ehemaligen Marinedienststelle nur noch Zivilisten, die inzwischen dafür zu sorgen hatten, eventuelle Reparationsschiffe mit dem erforderlichen Personal zu versehen.
Und genau an dem Tag, als dringend für ein Schiff Personal benötigt wurde, betrat ich diesen Raum. Das Erstaunen auf beiden Seiten war groß, als wir uns erkannten. Damals im Rang eines Leutnants, hatte er diese Uniform abgelegt und saß mir nun in ziviler Kleidung gegenüber. Wir haben sehr lange über alles gesprochen, haben uns aber beide sehr gut verstanden, und als ich nach über drei Stunden auf den Zweck meines Besuches zu sprechen kam, sagte er nur: „Ich habe was für Sie!“ Und dann erläuterte er mir, was gerade auf seinen Schreibtisch gekommen sei, und dass es sich um einen Neubau handeln würde. Genaueres konnte er mir noch nicht sagen, er wusste im Moment aber auch noch nicht mehr. Das war an einem Wochenende. Beim Abschied meinte er nur, Anfang kommender Woche wüsste er über alles eine Antwort, und ich wäre für diesen Posten fest vorgesehen!
Als ich dann auf der Straße stand, kam mir plötzlich der Gedanke, dass ich doch bisher sehr viel Glück gehabt hätte. Durch Frankreich, Belgien und Deutschland war ich bis nach Hamburg gekommen, und wenn ich jetzt noch eine Stelle auf einem Schiff erhalten würde, wäre ich fein raus, und all meine Mühsal der Flucht hätte sich dann gelohnt. Auch meine Fahrt durch Norddeutschland hatte für mich unter einem guten Stern gestanden. Einen Tag, bevor die Brücke in Köln – wegen Hochwassers – für alle Züge bis auf Weiteres gesperrt wurde, hatte der Zug, in dem ich saß, die Brücke noch passieren können.
Hamburg, an Bord des Hochseeschleppers MS. „NORDER-GRÜNDE“, im Februar 1946. Inzwischen war noch ein älterer Herr hinzugekommen, es war der 1. Ingenieur, dann noch zwei Reiniger und ich als Ing.-Ass. Es fehlten noch der 2. und der 3. Ing. und zwei Schmierer, dann wäre die Maschinenbesatzung vollständig.
Mit Jutta habe ich telefoniert, und ich habe vom 1. Ing. für vier Tage Urlaub erhalten, um nach Hademarschen zu fahren. Von Brunsbüttel musste ich laufen, es waren 45 km, die Strecke machte mir überhaupt nichts aus, ich war ja in Übung. Ich lief und lief, immer im strömenden Regen. Dann hatte ich Grüntal am Nord-Ostsee-Kanal erreicht und rief Jutta in Hademarschen an, die in einen Jubelschrei ausbrach und sich sehr freute. Sie kam mir entgegen, und wir konnten es einfach nicht fassen, dass wir uns, nach so langer Zeit, in den Armen liegen konnten und der Krieg schon in weite Ferne gerückt war. Es waren zwei herrliche Tage bei Jutta, und die verbrachten wir fast nur im Bett. Ausgehungert nach Liebe, war unser Tun wohl verständlich. Dann waren diese Tage leider vorbei, denn ich musste ja wieder an Bord. Wir fuhren gemeinsam nach Hamburg, und sie fuhr weiter nach Hannover, um irgend etwas zu regeln. Was sie da wollte, hat sie mir nicht direkt verraten, aber sie ließ durchblicken, sie wolle mal erkunden, ob in Hannover ein Zuzug leichter sei als in Hamburg.
Wieder an Bord stand die Maschinenprobe an. Alles verlief glatt, und es gab keine Beanstandungen, und man sprach davon, dass es nun in einigen Tagen losgehen würde. Dann hieß es, wir würden als Stammbesatzung an Bord bleiben und das Schiff nach Südafrika bringen...
...Wir lagen in der Werft auf Warteposition, ich ging mit dem 1.Ing. ins Kino und lebte sehr gut. Während an Land die Verpflegung bis aufs Äußerste knapp ist, haben wir keinen Mangel, so dass ich oft Freunde, wie „Bobby“ W. zum Essen einlud, die dann ordentlich reinhauen. Und so vergingen die Tage, und es tat sich nichts. Dann hatten wir eine Abwechslung, die Polizei kam an Bord und durchsuchte die Kammern der Matrosen.
Zwei Matrosen werden verhaftet, weil sie Hydrauliköl als Speiseöl verkauft haben, die Flasche zu 150,- RM. Wir sehen sie nicht wieder...
Leseprobe:
...So fuhr ich also in der Hoffnung wieder zurück nach Stralsund, irgendetwas in der Seefahrt zu finden.
Erste Begegnung mit Tauchern
Mitte Juli 1949 wanderte ich Richtung Rügendamm. Auf einem Gelände wurde tüchtig gearbeitet, die spätere Volkswerft war im Entstehen. Keine 50 Meter von mir entfernt arbeitet eine Taucherfirma an einer neuen Slipanlage für kleinere Schiffe. Sehr Interessiert, nein direkt fasziniert schaute ich dem Treiben auf dem Taucherschiff zu, und schlagartig wusste ich: Das ist der Beruf für mich! Am nächsten Tag bin ich frühzeitig zur Werft gegangen. Das Taucherschiff lag noch nicht auf Position, und ich konnte von der Pier direkt das Schiff betreten. Sechs Mann werkelten da so rum, und einer, ein kleinerer Mann, schien der Chef zu sein. Es war tatsächlich der Inhaber der Taucherfirma – Erich V. – und so erläutere ich ihm alles genau, was ich eigentlich wollte. Und es klappte. Er sagte zu mir, dass sie im Moment keine Zeit hätten, da das Schiff zum Arbeitsplatz verholen müsse. Ich solle an Bord bleiben und mir alles genau ansehen. Um 12:00 Uhr würden sie Pause machen, und dann wolle er weiter sehen. Meine sofort gestellte Frage, was damit gemeint sei – „dann sehen wir weiter“ – wischte er mit einer ausholenden Handbewegung weg. „Dann stecken wir dich in den Anzug und versenken dich in die Tiefe.“ Das war deutlich, er hatte also meinen Wunsch verstanden und wollte mich prüfen. So gut es ging, habe ich mir alles an Deck angesehen. Habe die Luftpumpe betrachtet, die Schläuche und einen Helm, eben alles, was so in Frage kam, wie ein Taucher in den Taucheranzug gelangte und vieles mehr. Die Zeit verging, und dann war es Mittag, und ich war an der Reihe. Der Chef hielt eine kurze Ansprache, warum – wieso – weshalb, und sagte noch, dass ich ein blutiges Greenhorn wäre, wenn ich aber die Aufgabe einigermaßen gut erledigen würde, dann hätte ich einen festen Platz in seinem Team! Dann wuchteten sie mich mit vereinten Kräften in den Anzug, Helm drauf, Gewichte dran, schwere Eisenschuhe an, bekam einen großen Holzbohrer mit einem sehr langen Stiel in die Hand gedrückt und die Prüfungsaufgabe zu hören. Danach sollte ich ein waagerechtes Loch, genau 150 Zentimeter vom Boden gerechnet, bohren.
Ich habe es geschafft, fast in der Zeit, die für eine solche Arbeit vorgesehen war. Als ich wieder an Deck stand, ging ein Taucher runter, um meine Arbeit zu überprüfen und das Ergebnis dem Chef mitzuteilen. Es war positiv und somit wurde ich ein Hilfstaucher und dem Taucher beigegeben, der meine Unterwasser-Bohrarbeit begutachtet hatte. Ich habe mit diesem Mann sehr gerne zusammen gearbeitet und habe von ihm alles gelernt auch so manchen Kniff erfahren! Er gehörte nicht zu den Menschen, die alles für sich behalten, in der Hoffnung, dass der Andere sich bald totlaufen würde. Nein im Gegenteil, er war offen und ehrlich! Ich verdiente sehr gut.
Das war die Grundlage, und somit unterließ ich nichts, um die Stellen, von denen ich glaubte, sie seien an meiner Enteignung Schuld, anzugreifen! Und dann kamen zwei Pleiten, die es in sich hatten. Ende September 1949 war unser Taucherchef verschwunden, er hatte sich zum Westen abgesetzt. Die Firma hatte sich über Nacht aufgelöst, und seine Hilfskräfte waren nun arbeitslos...
Leseprobe:
…Dann frage ich ihn, ob an der Zeitungsnotiz, betr. »Seemaschinistenausbildung« etwas dran wäre? »Natürlich« sagt er »wir suchen dringend Leute, die für knapp 6 Monate nach Wustrow gehen, um dort ein Patent zu erwerben.«
Er soll mich sofort für den Lehrgang vormerken und ich würde ihm gleich morgen meine Seefahrtsunterlagen vorbeibringen, da ich ja die erforderlichen Fahrzeiten als Ing. Assistent Iückenlos nachweisen könnte…
Seefahrtschule Wustrow
Dann war es soweit, ich musste nach Wustrow fahren, um pünktlich am 1. Februar 1950, (das war der Lehrgangsbeginn), in der Navigationsschule zu erscheinen.
Wir waren insgesamt acht Teilnehmer, wobei ich der einzige Schüler war, der bereits eine Seefahrtszeit nachweisen konnte.
Wir waren alle Mann in dem Hotel „Deutsches Haus“ untergebracht, wo wir auch verpflegt wurden. Morgens um 08:00 Uhr begann der Unterricht und dauerte bis 13:00 Uhr, dann zum Essen. Zweimal in der Woche war auch noch am Nachmittag von 15:00 bis 17:00 Uhr Unterricht. Unser Lehrer war Dozent an der Ingenieurschule in Stettin gewesen, und durch seine Flucht war er in Wustrow hängen geblieben.
Dann sollte sich so peu à peu eine Fischerei und Handelsschifffahrt entwickeln, aber dazu hatten sie im Osten sehr wenig Fachpersonal, und man war bestrebt, diesen Mangel zu beheben. In der Zeit des Lehrganges bin ich einige Male, jeweils an den Wochenenden nach Stralsund gefahren und auch mit Bärbel zu meiner Mutter, die immer strahlte, wenn sie ihr Bärbelchen sah. Bärbel besaß ein altes, schweres Damenrad, und das nahm ich mit nach Wustrow. An einem sehr schönen und sonnigen Wochenende, entschloss ich mich, mit dem Rad nach Stralsund zu fahren. Es waren mehr als 65 km, und ich fuhr bereits sehr früh los. Ich hatte schon über 30 km gefahren, als ich an einer Wiese vorbeikam, die voller bunter Blumen war. Ich habe einen wunderschönen bunten Strauß gepflückt, als an der Stelle, wo das Rad lag, ein Militärlastwagen hielt, auf dem mehrere russische Soldaten saßen. Ich dachte noch so bei mir: „Mein Gott, was wollt ihr denn von mir, lasst mich bloß in Frieden“, da rief einer vom Wagen runter: „Wirrr nach Stralsund und du?“ – „Ich auch nach Stralsund“, sage ich. Und er wieder: „Na komm, mach schnell, gib Rad rrauf, wirrr nehmen dich mit.“ Und so kam ich schon frühzeitig in Stralsund an.
In Wustrow, meinem Geburtsort, traf ich noch etliche Leute an, die ich noch von meiner Schulzeit her kannte. Sehr gefreut habe ich mich, als ich auf der Gegenseite der Strandstraße einmal einer ganz kleinen und gebückten Frau begegnete und ich sie, als sie hochblickte, als meine hoch verehrte Lehrerin, Fräulein Fabrizius, erkannte. Wir sprachen über die Vergangenheit und die Gegenwart – von der Zukunft wollte sie nichts hören, die sehe so traurig aus, dass man sich damit nicht noch die Laune vermiesen sollte. Dann lud ich sie noch zu einem Kaffee ein, und zum Abschied sagte sie mir noch einen netten Satz: „Mein lieber Immanuel, von all meinen vielen Schülern warst du der Frechste, aber liebeswürdig frech. Und fragen konntest du, ich wusste oft keine Antwort. Und weil du so hochintelligent warst, hattest du es immer besonders schwer in der Schule. Ich mochte dich sehr!“ An diesen letzten Satz von ihr denke ich sehr oft! Drei Wochen nach unserer Begegnung verstarb mein Fräulein Fabrizius. Ich war tieftraurig.
Der Lehrgang hatte am 1. Februar 1950. Dann kamen die Prüfungen, die ich alle mit »GUT« bestand. Am 24.07.1950 war der Seemaschinisten-Lehrgang beendet. Es war eine sehr schöne und abwechslungsreiche Zeit gewesen!
DDR-Hochseefischerei
Wir Lehrgangsteilnehmer hatten nach den sechs Monaten Schulzeit nicht viel Möglichkeit, Urlaub zu machen, denn kaum hatten wir die Prüfungen bestanden, saß uns schon das Arbeitsamt im Nacken. So wurde ich vermittelt an:
VVB – Vereinigung Volkseigener Betriebe der Fischwirtschaft,
Hochseefischerei Rostock,
Rostock Bramow
Am 17.08.1950 wurde ich als 2. Maschinist eingestellt und wurde kurze Zeit danach zum 1. Maschinisten befördert!
Nun etwas über den Beginn der Logger-Fischerei in der DDR. Da ich ja einer der ersten Mannschaften angehörte, so war lange Zeit das Hauptthema die Zusammenstellung der erforderlichen Leute für einen Logger. So waren Fachleute, wie zum Beispiel die Fischerei-Kapitäne eine ausgesprochene Mangelware. Während meiner Fahrzeit bei der Hochseefischerei, hatte ich zwei Logger, und wenn ich mich richtig erinnere, mit den Namen „VÖLKERFREUNDSCHAFT“ und „GESCHWISTER SCHOLL“. Damals hieß es immer, dass wir 10 Logger für die UdSSR bauten, und dann fiellt ein Logger für die DDR ab! Mit dem Bau von Loggern, größeren Fischereifahrzeugen und Fangschiffen, die lange auf See blieben und den Fang gleich verarbeiteten, errang die Stralsunder Volkswerft Weltruhm! Einen der beiden Logger holten wir aus Wolgast ab. Da das Schiff noch nicht ganz fertig war, (es dauerte noch eine Woche) wurden wir kurzer Hand auf dem Dachboden eines alten Lokals untergebracht, egal ob Kapitän oder Moses. Nach rund einer Woche erfolgte die Werft-Übergabefahrt in der Ostsee. Diese Tour dauerte einen vollen Tag, und nachdem es keine Beanstandungen mehr gab, wurde das Schiff an uns übergeben. Alle Logger waren stabil gebaut, nur etwas „schwach auf der Brust“, das heißt, die Maschinenleistung von 300 PS war viel zu gering. Der Hauptmotor war eine 8-Zylindermaschine, ein „Langsamläufer“ und für die Ewigkeit gebaut, ungeheuer schwer und stabil. Ich habe in der Zeit, in der ich auf einem Logger fuhr, nie Schwierigkeiten gehabt. Unser Kapitän war aus dem Westen gekommen – damals gab es ein Werbeprogramm in den Fischereihäfen der Bundesrepublik, woraufhin, viele Kapitäne den lukrativen Angeboten folgten und in die DDR überwechselten.
Wir fuhren auch nach Island, um Rotbarsch zu fangen. Da der Rotbarsch aber ein Tiefwasserfisch ist, so reichte leider die Leistung unseres Motors nicht aus, um erfolgreich fischen zu können. Während es den Fischdampfern aus dem Westen vollkommen egal war, aus welcher Richtung der Wind oder Sturm kam, musste unser Kapitän immer eine gewaltige Strecke, gegen Wind und Strömung andampfen, um dann mit dem Wind das Netz auszusetzen, um es dann stundenlang zu schleppen.
Beim Heringsfang auf der Doggerbank in der Nordsee, wo es nicht so tief war, lief es recht gut.
Wenn eine Fangreise – etwa 14 Tage – beendet war, liefen wir nie durch den Nord-Ostsee-Kanal nach Rostock, sondern immer durch das Skagerrak, Kattegat, durch den großen Belt, dann durch den Fehmarn Belt nach Rostock.
Unser Verdienst war angemessen. Wir bekamen, nach jeder Reise, auch ein Kontingent an Fisch, (ein Zusatzverdienst) der damals in der Bevölkerung reißend Absatz fand. Die Kameradschaft an Bord war gut, solange die Politik keine große Rolle spielte. Das änderte sich leider zusehend, als politische Schriften an Bord kamen und wir diese besprechen und kommentieren sollten.
Einmal fischten wir vor Bornholm. Dort ist eine Stelle, die ca. 100 Meter tief ist. Als wir das Netz einholten, hatten wir kaum Fisch, dafür eine Menge Gasbehälter (zum Teil stark verrostet) nach oben geholt, Überbleibsel aus dem 2. Weltkrieg, die hier versenkt worden waren. Viele Behälter waren undicht, und es dampfte und prustete eine bräunliche Brühe aus ihnen und lief über Deck. Dabei hatte ein Matrose sehr viel Hautberührung mit dieser unbekannten Substanz gehabt, und die Haut verfärbte sich, und das rohe Fleisch wurde sichtbar. Der Kapitän wollte den Mann nach (ehemals) Liebau bringen, doch die Russen ließen das nicht zu und beorderten uns nach Königsberg, wo wir den Matrosen mit seinen Verätzungen an den Händen und an den Beinen, dem Hafenkapitän übergaben, der alles Weitere dann veranlasste. Er kam in ein Marinehospital und wurde dort gut versorgt. Auch die Giftbehälter gaben wir in Königsberg an Land. Als wir etwa 14 Tage später in Rostock ankamen, war der Matrose auch schon da!
Aber, wie schon erwähnt, war die politische Entwicklung auf den Schiffen nicht in meinem Sinn. Die Kameradschaft zerbrach zusehends, und dadurch erlitt die Freude an der Arbeit einen gehörigen Dämpfer! So verlangte man von mir, dass ich meiner Maschinenbesatzung politisch gefärbte Vorträge halten sollte usw. Laufend wurden wir überwacht und das – nennen wir es Politbüro – führte über jeden genau Buch. Auch hier hatte ich sehr viel Glück.
Oft bin ich mit meinem, mir zugeteilten Fischquantum in die äußerste Ecke des Kombinates gelaufen, um dort über den Drahtzaun zu klettern. Wenn dann nach Hülsen gefragt wurde, hieß es immer, der sei gerade in die Werkstatt gegangen, um ein Ersatzteil zu bestellen. Und in Stralsund war es genau umgekehrt. Hier war ich, leider gerade eben nach Rostock gefahren. Und auf diese Art und Weise, bin ich den Häschern immer wieder entkommen.
In Stralsund hatten wir ein langes Seil an einem stabilen Tischbein befestigt. Im Falle eines Falles wäre dieses Seil mein Fluchtweg geworden. Wenn die Wohnungsklingel sich meldete, wurde sich am Fenster genau informiert – ob Freund oder Feind.
Dann kam noch eine für mich positive Telefonmöglichkeit zum tragen. Bärbel arbeitete im Zentralbüro der nördlichen DDR-Kraftwerke in Stralsund. Alle Kraftwerke waren durch eine nicht öffentliche Leitung untereinander verbunden. Da Bärbel für den obersten Chef arbeitete, konnten wir auf dieser Leitung immer die neuesten Verhältnisse erfahren. Wenn ich also mit dem Schiff nach Rostock kam, informierte ich mich erst über diese Kraftwerks-Telefonleitung, ob die Luft in Stralsund zurzeit, rein war.
Am 29. März 1951 habe ich gekündigt, ich hatte die Nase voll, denn die politische Ausrichtung nahm Formen an, die ich mit meiner freiheitlichen Einstellung nicht mehr akzeptieren konnte, noch dazu ich Aue-Geschädigter war!
Aber dann wurde es Ernst! Während meiner Lehrzeit in Stralsund hatte ab 1935 ich mit einem Lehrling zusammen gearbeitet, dessen Vater ein Russe war. Der Vater war im ersten Weltkrieg – 1914 – in der Schlacht bei Tannenberg, wo Hindenburg die Russen besiegte, in deutsche Gefangenschaft geraten, war in Deutschland – durch Heirat mit einer deutschen Frau – hängen geblieben, hatte mehrere Kinder gezeugt – und eins davon, war mein Lehrlingsfreund Erich P., der fast perfekt die russische Sprache beherrschte. Als dann 1945 der 2. Weltkrieg endete und daraufhin, die Russen auch nach Stralsund kamen, sich ganz langsam ein polizeiähnliches Gebilde entwickelte, da griffen sie auf meinen ehemaligen Lehrlingsmitstreiter zurück, beförderten ihn und verpassten ihm drei Sterne auf seine Schulterklappen, und somit war Erich – fast über Nacht – ein „CHEF“ geworden.
Ende März 1951 kam er zu uns und wollte mich alleine sprechen, und er teilte mir mit, dass ich auf der neuesten Liste derer stünde, die demnächst überprüft oder sofort verhaftet werden sollten – meine Verhaftung stehe bevor, und der Zeitpunkt liege im Ermessen des Polizeichefs, nämlich meines Lehrlingsfreundes aus alten Zeiten, Erich P.!
Wir haben hin und her überlegt, was wir in dieser Situation nun machen sollten. Ich wollte sofort Stralsund verlassen…
Leseprobe:
Tauchabenteuer vor Senegal
Nun zu dem Bergungsauftrag des ausgebrannten Frachters, noch eine Ergänzung. Zuerst sah es so aus, als würde es nur einige Tage dauern, bis wir das Wrack soweit seetüchtig gemacht hätten, um die weite Schleppreise nach Nordeuropa beginnen zu können. Aber dann stellten sich die Schwierigkeiten ein! Der Frachter lag auf der Seite mit einer Schräglage von ca. 30 Grad. Die Laderäume waren zum Teil voll gelaufen, so dass die Gefahr bestand, dass das Schiff auch ein Leck haben könnte. Alles, was nun an Materialien benötigt wurde, wie Pumpen, Schlepptrossen, Schläuche und vieles mehr, musste zeit- und kostenaufwendig in England bestellt werden.
Wir hatten sehr viel Freizeit und hatten ein Hafenlokal entdeckt, wo wir uns abends zum Bier trafen. Draußen an der Fensterscheibe war zu lesen, dass man außer Englisch, Französisch und Schwedisch auch noch Deutsch sprechen würde und so hatten wir dieses Lokal als unser „Stammlokal“ erkoren! Die weibliche Bedienung, die dann an unseren Tisch kam, war nicht mehr ganz jung und sprach uns gleich auf Deutsch an und stellte sich als „Lissi“ vor. Geboren war Lissi in Grevesmühlen, einer kleinen Stadt in der Nähe von Wismar. Wie sie in den Senegal gekommen und dort hängen geblieben war, verschwieg sie allerdings.
In den verschiedenen Gesprächen hatte sie mitbekommen, dass ich auch als Taucher gearbeitet hatte – wie das so ist, wenn man ein paar Bier und Schnäpse intus hat, da redet man schon mal etwas mehr, und so kam es, dass sie mich ansprach und fragte, ob ich wirklich getaucht hätte und wenn ja, dann hätte sie für mich einen Job! Lissi war es, die mich mit einem korpulenten Mann bekannt machte, der mich gleich in einem einwandfreiem Deutsch befragte: „Ich habe eine prima Sache für Sie, jetzt habe ich noch allerlei zu tun, und außerdem ist es mir hier auch zu warm, und deswegen möchte ich Sie bitten, mich heute Abend zu besuchen.“ Dann gab er mir seine Adresse und verschwand. Nach vieler Mühe hatte ich das Haus endlich gefunden. Es war eine piekfeine Gegend, und das Haus machte einen tollen Eindruck. Mit einmal kamen mir Zweifel, und ich wusste einen Moment lang nicht, was ich tun sollte. Dann siegte aber doch die Neugier und die Aussicht auf eine Menge Geld! Nachdem ich den Klingelknopf gedrückt hatte, ertönte unmittelbar über mir eine Stimme: „Hallo Mister, ich habe Sie schon gesehen und mich gewundert, was Sie so lange überlegen. Kommen Sie rein, die Tür ist offen.“ Also nichts wie rein! In der Halle saßen drei Männer, die mich sehr direkt musterten. Dann kam mein Gesprächspartner die Treppe runter und stellte mich den anderen Männern vor.
Es wurde ein interessanter Abend, wo viel getrunken und hervorragend gegessen wurde. Einer war mir besonders aufgefallen. Es war ein sehr lebhafter Mann, den sie Arif nannten. Er sprach viel mit dem Gastgeber, und beide waren wohl die Chefs des Unternehmens, wobei die beiden anderen Männer sich kaum an der Unterhaltung beteiligten. Nach dem pompösen Essen sagte man mir, ich möge es mir für eine halbe Stunde gemütlich machen und mich wie zuhause fühlen, da sie meinetwegen im Nebenraum noch etwas besprechen müssten. Nach weniger als 30 Minuten erschienen die vier Herren wieder. Der korpulente Herr kam gleich zur Sache und erläuterte mir, wie es weiter gehen sollte. „Wissen Sie“, sagte er, „wir sind alles ehrliche Kaufleute. Wir treiben Handel, und unsere Geschäftsverbindungen sind international. Uns stehen Schiffe und Flugzeuge zur Verfügung, und Geld spielt keine Rolle. Für die Arbeit, die wir Ihnen vorschlagen wollen, zahlen wir Ihnen bar auf die Hand 1.000 US Dollar, das heißt, 500 Dollar sofort und den Rest nach Beendigung der Arbeit. Es ist für Sie ein leicht verdientes Geld, und die ganze Angelegenheit dauert an Ort und Stelle nicht länger als ungefähr eine Stunde.“ Ich sah ihn immerfort nur an. Bäche von Schweiß liefen von seiner Stirn, tropften auf den Tisch oder verschwanden in seinem Hemdkragen. Es war stickig und sehr heiß. Die anderen Männer saßen rauchend dabei, sagten aber kein Wort. Dann fuhr der Chef fort: „Wenn Sie sich aber entscheiden sollten, diesen Job nicht anzunehmen, so geben sie den kleinen Vorschuss wieder her und verlassen Sie dieses Haus. Sie hätten dann weiter nichts zu tun, als zu vergessen, dass wir uns jemals kennen gelernt haben!“ Letzteres sagte er allerdings mit solchem Nachdruck, dass ich an „ehrliche Kaufleute“ nicht mehr glauben konnte. Dann war ich an der Reihe und sagte zu ihm, dass ich den Job sofort annehmen würde, sofern er mir die Prämie verdoppeln würde, als Vorschuss erwarte ich also 1.000 Dollar, und er solle mir nun endlich sagen, was er eigentlich von mir für eine Arbeit verlangen würde?
Der Chef war aufgestanden und goss sich Wasser in ein Glas. Nachdem er getrunken hatte, meinte er: „Nun gut, dann will ich Ihnen sagen, worauf es ankommt. Beim Überladen auf See sind uns drei sehr wertvolle Kisten über Bord gegangen, die wir, koste es, was es wolle, wieder haben müssen. Die ungefähre Stelle ist markiert, und es ist Ihre Aufgabe, diese Kisten zu finden. Vermeiden Sie bitte weitere Fragen! Sie sind nur angestellt, um die Kisten zu bergen. Damit ist ihr Auftrag erfüllt, Sie erhalten Ihr Geld, und dann bringen wir Sie wieder zurück zu Ihrem Schiff. Sie können dann tun und lassen, was Sie wollen. Nur auf eines weise ich Sie noch mal ausdrücklich hin – für Sie gilt danach absolute Geheimhaltung – im Übrigen erhöhen wir Ihre Prämie auf 2.000 Dollar.“ Aus seiner Brieftasche holte er meinen Vorschuss von 1 000 Dollar, die er mir in die Hand drückte. Dann fragte er mich noch mal, ob nun zwischen uns alles klar sei, worauf ich nur „Ja“ sagte.
Sofort nahm ich auf meinem Schiff Urlaub für drei Tage. Am nächsten Tag ging ich schon sehr früh in die Hafenbar und war erstaunt, dass Arif schon auf mich wartete. Ihn fragte ich nach den Tauchgeräten, dem Zustand und dem Alter. Mit Erstaunen hörte ich, dass alles nagelneu sei und die beiden Geräte ihnen erst kürzlich über einen Makler aus Deutschland ausgeliefert worden seien. Nach einer kurzen Besprechung zwischen Arif und mir fuhren wir mit seinem Wagen zu einem Hof, auf dem ein kleiner plangedeckter, Lieferwagen stand. Arif stieg auf die Pritsche und meinte, dass ich ihm folgen solle. Auf der Ladefläche des Wagens standen zwei große Holzkisten. Sie waren dunkel gestrichen und noch ganz neu – es waren die Taucherkisten.
Nun scheint es wohl ernst zu werden, dachte ich und sah dabei meinen Begleiter an, der aber von mir keine Notiz nahm. Wie lange wir fuhren, weiß ich nicht mehr genau. Dann war die Fahrt zu Ende, und die Plane wurde gelöst. Vor mir lag ein Boot, ein Gedicht von einem Boot. Es war sehr lang und schnittig, wie ein Rennboot gebaut. Der Wagen stand rückwärts zu einem Bootsanleger, und ich sah, wie einige Männer vom Boot her auf den Wagen zukamen. Ich sprang auf die Erde und ging mit Arif über den Laufsteg zum Boot. Hinter uns trugen die Männer die Ausrüstungsgegenstände, u. a. auch die beiden Taucherkisten.
Wir gingen an Bord, und im Ruderhaus stand der Chef und fragte mich gleich, was ich von seinem Boot halte und wie es mir gefallen würde. Er war sehr stolz auf sein Boot. Beiläufig fragte ich ihn, wie ich denn Luft bekäme. Ich hätte keine Luftpumpe gesehen, worauf er mir sagte, dass in der Maschine eine moderne Kompressorenanlage installiert worden sei, das modernste Gerät, was auf dem Markt zu bekommen wäre – hätte er extra für mich einbauen lassen! Dann wurde er wieder förmlich, und er wies mich an, alles zu überprüfen denn spätestens in zwei Stunden würde die Fahrt losgehen. Mit diesen Worten war ich entlassen. Ich überprüfte den Inhalt der beiden Kisten, Telefonanlage, die Luftschläuche und vor allen Dingen die Luftanlage. Es war nichts zu beanstanden, alles war neu und vorschriftsmäßig. Der Taucherhelm war blank und wie poliert. Ich hatte ihn aus der Kiste geholt, und er funkelte in der Sonne. Ich dachte daran, mit was für altertümlichen Helmen, die mit Patina überzogen waren, ich in meinem Leben schon getaucht hatte. Zerbeulte Helme waren darunter gewesen, die ausgesehen hatten, als hätte ein Elefant mit ihnen Fußball gespielt. Dabei betrachtete ich den hell in der Sonne glänzenden Helm, ohne zu ahnen, dass mir dieses Glänzen und Funkeln zwei Tage später das Leben retten sollte. In der anderen Kiste fand ich Schläuche, Anzüge, Telefonkabel und vieles mehr. Dann fand ich noch einen kleinen Kasten, der das Telefon enthielt. Es war alles in Ordnung, was ja auch kein Wunder war – es waren ja alle Gerätschaften fabrikneu. Dann ging ich in den Motorenraum, um mir die Luftanlage und den Kompressor anzusehen. Auch hier hatte ich keinerlei Beanstandungen. Dann wollte ich mich oben an Deck noch etwas umsehen. Dabei fiel mir auf, dass auf den Rettungsringen nicht einmal der Name des Schiffes stand. Selbst das Schiff war namenlos, jedenfalls für die kommende Aktion.
Als ich mich dann zum Chef, der an der Steueranlage des Schiffes stand, begeben wollte, rief dieser mir zu, das ich ab sofort an Deck nichts mehr zu suchen hätte und ich mich in meine Kammer begeben solle – und zwar sofort! „Übrigens, ist die Taucheranlage klar?“ Ich nickte nur zustimmend und verzog mich in die mir zugewiesene Unterkunft. Ich legte mich auf das Bett, und da der Raum klimagekühlt war, dauerte es auch nicht lange, und ich war eingeschlafen.
Als ich aufwachte saßen der Chef und Arif an meinem Bett, und mir wurde aufgetragen, drei Leute sofort in den Handgriffen zu unterrichten, damit ein einwandfreier Verlauf des Tauchereinsatzes erfolgen würde. Dabei erfuhr ich, dass keiner der Leute jemals etwas mit der Taucherei zu tun gehabt hatte. Ich erklärte also den Leuten, wie man in den Anzug kommt, wie das Bruststück mit dem Anzug verbunden wird, wie die Gewichte angehängt werden usw. usw.
Meinen Vorschuss, die 1.000 Dollar, verstaute ich in eine kleine Nebentasche, die auf der Innenseite meiner Hosentasche aufgenäht war. Dadurch rettete ich später wenigsten die Hälfte meines Verdienstes, aber das ahnte ich jetzt natürlich in keiner Weise. Oben sah ich in eine riesige Hecksee. Das Meer war allgemein ruhig, doch war der Fahrtwind sehr heftig, und ich schätzte, dass das Boot über 20 Knoten laufen würde. Dann konnte ich einen Blick auf den Fahrtmesser werfen und sah, dass die Nadel des Gerätes zwischen 25 und 26 Knoten pendelte. Auf der Backbord-Seite sah ich, nicht weit entfernt, die Küste, an der wir in südlicher Richtung mit hoher Fahrt entlang rasten. Alle Achtung, der Chef hatte einen flotten Renner, und die „Marschfahrt“ mit 25 Knoten war ja beachtlich!
Dann wurde es dunkel, und das Boot fuhr nur noch mit Schleichfahrt. Am nächsten Morgen kam der Chef, und ohne mich zu begrüßen sagte er, dass ich das Tauchgerät klarmachen solle. „Nachmittag zwischen 14:00 und 15:00 werden wir die Stelle erreichen, und dann beginnt Ihr Einsatz, und ich hoffe, dass Sie erfolgreich sind. Von den Männern, die Sie geschult haben, suchen Sie sich den Besten aus, und dem bringen sie noch mal alle Handgriffe bei. Ich möchte nicht, dass etwas passiert!“ – „Ich möchte nicht, dass etwas passiert.“ – An diesen Satz habe ich später noch sehr lange denken müssen!
Trotz der Sprachschwierigkeiten begriff mein neuer Helfer schnell, und wir hatten die beiden Kisten bald ausgepackt, den langen Luftschlauch angeschlossen, das Telefon montiert. Kurz und gut, bei uns war alles klar! Zu dieser Ausrüstung gehörte ein Pressluftbrustgewicht. D. h., gegenüber den einfachen Blei- oder Eisenbrustgewichten waren hier in einem kleinen Gusseisenbehälter zwei Stahlflaschen angeordnet, die mit Luft von 150 atü gefüllt waren. Das Ganze war mit zwei Karabinerhaken am Schulterstück befestigt, und ein kleiner Druckschlauch stellte die Verbindung zum Helm her. Unterhalb der beiden Flaschen war ein kleines Ventil, das der Taucher im Falle einer Gefahr öffnen konnte. Dann strömte die Atemluft aus den Flaschen durch den dünnen Schlauch direkt in den Helm. Das Ventil bei den Hilfsflaschen hatte ich probeweise mal kurz geöffnet, und zischend strömte die Luft ins Freie. Lass nur nicht soviel von dem guten Stoff raus, dachte ich, vielleicht brauchst du diese Luft noch. Damit hatte ich unbewusst den Nagel auf den Kopf getroffen. Dann machte ich meinem Helfer noch klar, wie man mühelos in den Gummianzug steigt und dass wir zum Anziehen drei Mann benötigen würden. Als ich nun glaubte, dass alles perfekt sei, meldete ich dem Chef, dass alles klappen müsste und dass beim Tauchgang der Leinenmann ein sehr wichtiger Helfer wäre. „Ich bediene das Telefon“, sagte der Chef, „und Arif nimmt Sie an die Leine, und da wir ja die gleiche Sprache sprechen, bin ich wohl für Sie der beste Telefonist. – Sie werden staunen, wie leicht man bei mir zu Geld kommen kann. Das Tauchgerät werde ich in Zukunft noch oft verwenden, und Sie können sich schon mal Gedanken machen, ob Sie nicht für mich arbeiten wollen. Na, darüber können wir heute Abend noch einmal ausführlich sprechen.“ Aus dem Gespräch wurde nichts mehr.
Das Boot fuhr langsam weite und engere Kreise. Im Vorschiff standen zwei Mann, die unentwegt mit Ferngläsern die See absuchten. Kurze Zeit später hatte einer von ihnen einen Gegenstand auf dem Wasser entdeckt, es war die kleine Markierungsboje. Das Boot machte keine Fahrt mehr, als der Anker fiel. Einige Meter neben der Bordwand schwamm die kleine Boje. Der Chef hatte alle um sich versammelt, erteilte Anweisungen, und von ihm ging eine starke Nervosität aus, als er zu mir kam und meinte, dass hier etwa die Kisten liegen müssten. Ich hatte mich auf eine der Taucherkisten gesetzt und mir eine wollene Hose und ein Paar lange Strümpfe geangelt. Diese Sachen wollte ich überziehen, damit die Falten des Gummianzuges unter Wasser nicht so kneifen konnten. Dann stieg ich in den Taucheranzug, und vier Mann halfen mir, damit ich mit meinen Schultern durch den engen Gummikragen kommen konnte. Man zog mir die schweren eisernen Schuhe an und stülpte mir das Schulterstück über. Dann sagte ich, dass sie den Kompressor laufen lassen sollten. In dem Helm, der noch neben mir lag, hörte ich die Luft rauschen. – Die Anlage war klar! Dann kam der Chef zu mir und fing wieder ein langes Palaver an, und ich sagte ihm, dass ich längst alles verstanden hätte und dass dieses Kistensuchen bestimmt nicht zu meinen schwierigsten Taucherarbeiten gehören würde. Er solle jetzt mal ruhig sein und lieber für eine Leiter sorgen, denn sonst könnte ich nicht ins Wasser gelangen. Im Stillen hoffte ich, er hätte an eine Leiter nicht gedacht. Aber weit gefehlt, der Chef ließ eine Leiter anschleppen und außenbords befestigen. Sie war zwar etwas kurz und steil, aber es ging.
Ich sah mir die Leute noch mal alle der Reihe nach an – und komisch, irgendwie hatte ich ein sehr dummes Gefühl in der Magengegend. Aber die Würfel waren ja bereits gefallen, und so ließ ich mir kurz entschlossen den Helm aufsetzen. Ich erhob mich, damit sie mir den Leibriemen umbinden und die Gewichte anhängen konnten. Der kleine Luftschlauch von der Pressluftflasche wurde angeschlossen und das Telefon probiert. Zum Schluss ließ ich mir noch die Helmfenster von innen auswaschen, damit sie nicht beschlagen, und dann drehte mir Arif die große vordere Scheibe zu.
Jetzt war ich mit der Außenwelt nur noch durch das Telefon verbunden. Ich stieg auf die Leiter und fasste das Grundtau an, das mich nach unten führen sollte. Die Lotung hatte knapp 20 Meter Tiefe ergeben. Jetzt stand ich auf der letzten Leitersprosse, und das Wasser ging mir bis an die Brust. In der Hand hielt ich das Grundtau fest. Mit den Beinen gab ich mir einen Stoss und ließ gleichzeitig etwas Luft aus dem Helm entweichen. Ich sah nach oben. Die ganze Mannschaft sah auf mich nieder. Nachdem ich noch etwas Luft entweichen ließ, schlug kurze Zeit später das Wasser über meinem Helm zusammen. Nach unten schauend, konnte ich die Konturen des Meeresboden genau erkennen. Das Wasser war klar wie Glas, und langsam ließ ich mich nach unten gleiten.
Unten angekommen, wirbelte ich auf dem harten Meeresboden nicht mal Sand oder Schlick auf, und eine Unmenge Fische umgab mich. Über mir konnte ich den Bootskörper ganz deutlich erkennen, und die Weitsicht schätzte ich auf gut 40 Meter. Es war ein berauschendes Gefühl, in einem enorm klaren Wasser zu tauchen.
Die da oben, war es Zufall oder Können, hatten das Boot fast punktgenau geankert. Ich gab durch das Telefon, die Verbindung war sehr gut, die Anordnung, das Boot, so langsam es ging, durch den Wind rückwärts treiben zu lassen. Dann hatte ich den Eindruck, dass das Wasser flacher würde, und als ich nach oben fragte, was das Lot anzeigen würde, erhielt ich die Antwort, dass es im Moment 14,5 Meter Wassertiefe wäre!
Da, plötzlich sah ich links von mir, verzerrt durch das Wasser schimmernd, eine große Kiste liegen. „Stopp!“ schrie ich nach oben, „ich habe die erste Kiste gefunden!“ Keine Antwort. – Ich stand jetzt unmittelbar vor der Kiste, die sehr groß war und mir bis an die Schulter ging. Nicht weit von mir entdeckte ich die zweite und dritte Kiste und meldete meinen Fund nach oben. Wieder wartete ich vergebens auf Antwort! Ich rief immer wieder, man solle mir nun endlich eine Leine runter geben, damit ich die erste Kiste befestigen könne, doch nichts rührte sich.
Nun hatte alles so schön geklappt, ich hatte die Kisten gefunden, und nun versagte anscheinend das Telefon. – Doch, was war das? Über mir sprang der Motor des Bootes an, und ich vernahm das Klick, Klick, Klick, Klick der Ankerwinde. Was wollen die denn jetzt? Sind die da oben verrückt geworden? Was wollen sie nur, wir liegen doch mit dem Boot ausgezeichnet? Warum wollen sie denn das Boot verholen? Meine Bemühungen, mit der Oberwelt eine Verständigung zu herbeizuführen blieben erfolglos. Das Boot nahm jetzt Fahrt auf. Zwar langsam erst, aber ich musste mit. Die Kisten verschwanden aus meinem Blickfeld. Meine Signalleine war steif, und mich zog das Boot jetzt schon ziemlich schnell über den Meeresboden. Klick, Klick, Klick, Klick machte die Ankerwinde jetzt ganz schnell. Ich schrie und tobte, wissend, dass mich keiner hören würde, verspürte ich ein unheimliches Gefühl, das war „Todesangst“. Umgerissen, zog mich das Boot, und ich bekam Auftrieb, und ich dachte nur, hoffentlich kommen die Signalleine und der Luftschlauch nicht in einen der beiden Schiffspropeller.
Durch meine Lage war ich kaum noch in der Lage, mein Luftventil im Helm mit dem Kopf zu betätigen, und ich wurde immer dicker und musste die Luftregulierung durch die Armmanschetten (die Hände sind frei im Wasser) vornehmen.
Doch dann erstarrte mir das Blut in den Adern. Die beiden Motoren brüllten auf, und schlagartig nahm das Boot Fahrt auf, und ich merkte, wie die Signalleine lose wurde und ich nur noch am Luftschlauch hing, das war also nun die einzige Verbindung zum Schiff. Aber der Luftschlauch war nicht für eine Dauerbelastung dieser Art gedacht und würde irgendwann reißen – und was dann? Dann treibe ich irgendwo hilflos im Meer mit einem winzigen Luftvorrat. Und wenn dieser aufgebraucht ist, dann? – Ja dann wäre es aus und vorbei. Vielleicht würde ich gerettet – aber von wo sollte wohl Hilfe kommen?
Dann gab es einen Ruck, der Schlauch war wohl gerissen, und ich schwamm wieder senkrecht und konnte nur noch die gewaltige Hecksee sehen, die das mit Höchstfahrt ablaufende Boot erzeugte. Hilflos trieb ich nun im Meer. An eine Rettung konnte ich nicht glauben. Das bisschen Luft in meinen beiden kleinen Flaschen gestattete mir nur noch eine kurze Lebensfrist – bei sparsamster Verwendung vielleicht 30 Minuten, aber dann war Schluss!
Es sei denn, in dieser Zeit würde man mich finden – und sie fanden mich tatsächlich. Eine blaue Hochsee-Motorjacht aus Süd-Afrika auf dem Weg zu den Cap Verden musste meinem ehemaligen Chef höllische Angst eingejagt haben. Die blaue Farbe der Jacht hatte ihn wohl irritiert, und er hatte es wohl als ein Militärschiff angesehen. Mich hätte er geopfert. Der Eigner der Jacht hatte sich gewundert, warum dass andere Boot mit einem Mal mit hoher Geschwindigkeit ablief. Das Blinken und Glitzern meines Helmes war ihm aufgefallen. Durch das Fernglas hatte er dann das sonnenglitzernde Etwas entdeckt. Dann sah ich vor mir die große Jacht, und mit vereinten Kräften holte man mich aus dem Wasser. Zurück ging es nach Dakar, wo der Schiffseigner sowieso zum Tanken hin wollte. Was er mit der Taucherausrüstung gemacht hat, weiß ich nicht. Wir hatten verabredet, dass ich stillschweigend in Dakar von Bord gehen sollte. Tausend Mal habe ich mich bedankt für die Rettung – so quasi in letzter Minute!
Leseprobe:
...Aber ein Erlebnis sollte ich trotzdem nicht unerwähnt lassen, da es zeigt, dass unter Wasser trotz aller Vorsicht mancherlei passieren kann. Die Untersuchungen am Wrack waren beendet und das Ergebnis gut. Das Wrack lag wie zum Bergen geschaffen, und das Wasser war kristallklar. Stellenweise konnte man unter dem ganzen Wrack durchsehen, da es auf großen Steinen lag. Einzig und allein war die relativ starke Dünung unangenehm. Da das Wasser nicht tief war, verspürte man sie sehr stark. Da das Wetter günstig war, landeten wir erhebliche Mengen Schrott an. Da es in Schweden fast die ganze Sommernacht über hell ist, so arbeiteten wir meistens von morgens 03:00 Uhr bis 21:00 Uhr – mit den benötigten Pausen. Und dann war es eines Tages so weit, das Wrack war bis zum Doppelboden geräumt. Verschwunden waren die Aufbauten, Bordwände, Maschinenteile, Welle und Propeller etc. Geblieben war allein der Doppelboden. Um nun den Doppelboden gut sprengen zu können, war ich unter den Schiffsboden gekrochen und hatte meine Sprengladung angebracht. Sie riss einen Tunnel, und ich musste bald die Mitte des Schiffes erreicht haben. Die nächste Sprengladung wollte ich von der anderen Wrackseite her anbringen. Hierzu war es erforderlich, dass ich über den Doppelboden klettern musste, um so von der anderen Seite unter das Wrack kriechen zu können. Außerdem musste ich zwischen zwei großen Steinen durch, auf denen der Schiffsboden lag. Die Dünung war sehr hinderlich und der Tunnel wirkte wie eine Düse. Jedes Mal wurden große Wassermengen durch den Sprengschacht gedrückt, und war es unter dem Schiffsboden daher äußerst turbulent. Nach weiteren Metern war ich in der Nähe meiner alten Sprengstelle, und es fiel genügend Licht in den Tunnel, um alles gut sehen zu können. Um mich herum war es sehr eng, und die Bewegungsfreiheit war gering. Dann hatte ich den richtigen Platz für die nächste Sprengung ausgemacht, und so beschloss ich, nach oben zu gehen, um mir die nächste Sprengladung zu holen. Man hatte mir schon die Sprengladung fertig gemacht, und kurze Zeit später lag ich wieder in dem Tunnel, mühsam ein schweres Sprengpaket vor mich herschiebend. Der Tunnel war ungefähr sechs Meter lang und so eng, dass ich grade noch mit dem Taucherhelm durchkommen konnte. Schritt für Schritt kämpfte ich mich zu der Stelle vor, wo ich meine Sprengladung anbringen wollte. Drückend und saugend schob sich das Wasser durch den schmalen Tunnel, in dem ich lag und mit größter Kraftanstrengung versuchte, das Sprengpaket anzubringen. Durch die hin- und herströmenden Wassermassen wollte es mir einfach nicht gelingen. Hinzu kam, dass während der Zeit meines Aufenthaltes unter dem Boden der BRITKON die Dünung stark zugenommen hatte! – Nach großer Mühe und vielem Schimpfen hatte ich dann endlich mein Paket gut befestigt und auch das Sprengkabel irgendwo angebunden. Da fing plötzlich das Telefon in meinem Helm an zu quaken. Bei dem Rauschen um mich her war es mir nicht möglich, die oben sauber zu verstehen. – Ich lag auf dem Bauch, die Arme weit vorgestreckt und hatte vielleicht eine Bewegungsfreiheit zwischen dem Meeresboden und dem Boden des Schiffes von ca. fünf Zentimetern. An meinem Helm klapperte es, als schütte man Erbsen in einen Topf. Es waren Sand und kleine Steine, die durch die starke Strömung durch den Tunnel, in dem ich lag, gespült wurden. Mein Sprengpaket hatte sich etwas gelockert, und ich wollte noch einen Stein, der vor mir lag, ranschieben. – Ununterbrochen wurde im Telefon gesprochen, und bei größter Konzentration verstand ich, dass ich sofort raufkommen sollte, da das Wetter zusehends schlechter würde und die Gefahr bestünde, dass der Anker auf dem felsigen Boden nicht mehr lange hielt. Ich versprach, mich zu beeilen und sagte ihnen, dass ich gleich fertig wäre und dann raufkäme. Alles hatte geklappt und die Ladung saß nun endlich so fest, wie ich es haben wollte. – Nun brauchte ich also nur noch langsam rückwärts kriechend meinen Tunnel verlassen und konnte dann aufsteigen. – Als ich mich jedoch von meiner Sprengladung entfernen wollte, kam ich nur einen knappen Meter rückwärts gekrochen, dann saß ich fest. Irgendetwas hatte sich in meinen Gürtel verhakt und hielt mich fest. Nach vorne ging es auch nicht, denn gleich darauf spürte ich wieder, wie ich hinten festgehalten wurde. – Wieder die 50 cm zurück, – fest. 50 cm voraus, – fest. Und dabei die Dünung, die rücksichtslos durch den schmalen Tunnel unter dem Wrack hin- und her schoss. Nach oben gab ich Bescheid, wie es bei mir aussah. Dass man mir nicht helfen konnte, wusste ich genau. – Immer und immer wieder versuchte ich frei zu kommen, aber der Spielraum von 50 cm vergrößerte sich um nichts. – So lag ich unter dem Wrack, die Arme vorgestreckt in der gleichen Weise, in der ich vor ca. 30 Minuten in diesen verdammten Tunnel gekrochen war. Der Gedanke daran, der Anker würde evtl. nicht mehr lange halten, ließ mich pausenlos versuchen, aus meinem Gefängnis freizukommen. Leider war es mir auch nicht möglich, wenigstens eine Hand an den Körper zu bekommen. Wäre mir das gelungen, hätte ich vielleicht das Tauchermesser nehmen können und mich damit freischneiden. Aber nein, ich saß erbarmungslos fest, und dabei wurde über mir das Wetter immer schlechter. – Klar war mir allerdings nicht, wie und wo ich festsaß. Ich konnte am Gürtel hängen, am Schrittriemen oder an der Signalleine. Aber alles ist aus einem Material gefestigt, das niemals ein Mensch zerreißen kann, auch nicht in der Todesangst! –Ich hatte die Befürchtung, mir könne durch das Hin- und Herscheuern der Anzug zerreißen. Was das bedeuten würde, wusste ich genau. In meiner Lage würde ich wie eine Ratte versaufen. Dazu kam noch das dauernde Gefrage, wie es mir ginge, was ich mache und was ich zu tun gedächte. Als sie mir dann noch runter riefen, dass das Wetter immer schlechter würde und sie nicht mehr lange liegen bleiben könnten, da Gefahr für Schiff und Besatzung bestünde, schrie ich nach oben, dass sie mich nun endlich mit ihrem Geklage zufrieden lassen sollten. Meinetwegen sollte einer zur Insel schwimmen und von den Lotsen über Funk einen zweiten Taucher anfordern, der mich dann aus der Falle holen sollte. Ansonsten sollten sie gefälligst endlich den Mund halten, das wäre für mich im Moment die größte Hilfe. – Als ich dann feststellte, dass ich schon über zwei Stunden in meinem Gefängnis saß, verließ mich auch der Mut. –
Keiner, der nicht in einer ähnlichen Situation gesteckt hat, wird ermessen können, was ich in der Zeit durchmachte. Meine Lage war annähernd hoffnungslos. Sollte wirklich fremde Hilfe kommen, so konnten sie vor zwei Stunden nicht an Ort und Stelle sein. Diese Zeit konnte ich unter dem Wrack auf keinen Fall mehr überstehen. – Was nun tun? Ich versuchte, eiskalt zu überlegen. Erst einmal also die Sprengkabelzuführung zur Dynamitladung entfernen. Nun konnte wenigstens nichts mehr diesbezüglich passieren. Es ist ja auch kein angenehmes Gefühl, wenn direkt vor der Nase 10 kg Sprengstoff liegen. –
Und dann kam mir der Gedanke, dass ich für meine Befreiungsversuche die Kraft des Wassers ausnützen müsste. So versuchte ich es nochmals und zerrte mit der Kraft der Verzweiflung an meiner Fessel. Immer 50 cm voraus und dann mit voller Kraft dieselbe Strecke zurück. Dabei benutzte ich jetzt systematisch die Kraft des voraus- und rückflutenden Wassers. Ich war in Schweiß gebadet und am ganzen Körper wie zerschlagen. Furchtbar war die Gewalt des Wassers, das sich rauschend, gurgelnd und brausend durch die schmale Öffnung zwängte, in der ich lag. Der Sturm musste oben enorm zugenommen haben und es konnte einfach nicht mehr lange gut gehen! Und dann kam die See angerollt, die mir endlich die Freiheit brachte. Ich spürte schon vorher die Kraft. Sie schob ungeheure Wassermassen vor sich her, und mein Gefühl sagte mir, dass das jetzt die Freiheit bedeutete. Mit aller Gewalt arbeitete ich an meiner Befreiung. Im Telefon hörte ich gleichzeitig großes Geschrei; verstand aber nicht, was man mir sagen wollte. Sicher warnte man vor der anrollenden See, die dann plötzlich da war. Eine ungeheure Kraft presste sich durch meinen engen Tunnel, und einen kurzen Augenblick hing ich an dem Widerstand fest, wie ein Fisch an der Angel. Dann ein Ruck, ich war frei, und die Gewalt des Wassers spülte mich weit aus meinem Gefängnis. Ich ließ mich nach oben treiben, und dann sah ich in der aufgewühlten See, wie man sich an Bord des Sprengbootes abmühte, mich in die Nähe der Leiter zu ziehen.
Kurze Zeit später stand ich an Bord, und wir konnten die Ursache meiner Gefangenschaft ganz genau in Augenschein nehmen. Es war ein zum Haken gebogener, bleistiftstarker, Eisendraht, der sich so in meinen Gürtel und in meine Leine verhakt hatte, dass es für mich beinahe kein Entrinnen mehr gegeben hätte. Meine stundenlangen Bemühungen, frei zu kommen und die Kraft der letzten Dünungswoge hatten ihn endlich durchbrechen lassen. Jetzt hing er als stummer Zeuge einer fast vollendeten Tragödie an meinem dicken Ledergürtel. Das Wetter war in der Zwischenzeit so schlecht geworden, dass die Rettung buchstäblich in letzter Minute erfolgte.
Leseprobe:
So kam es, dass ich am 01. März 1960 mein Studium an der Staatlichen Schiffsingenieur-Schule in Flensburg aufnahm und das Studium am 20.07.1961 erfolgreich abschloss! Für mich war alles sehr schwer, und von Semester zu Semester musste ich immer härter kämpfen, um am Ball zu bleiben. Ich war mit Abstand der Älteste und wir hatten Abiturienten dabei, die alles von links machten. So kam es etliche Male vor, dass man mich animieren wollte mit zum Tanzen zu gehen. Aber dann fehlte mir die Zeit. Ich musste mühsam den Stoff des Tages am Abend bis in die Nacht aufarbeiten, und wenn andere Zimmergenossen weit nach Mitternacht nach Hause kamen, dann saß ich noch über den Büchern. Nein leicht war es für mich nicht, und sehr oft habe ich geflucht über meine Dummheit, diesen Weg des Ingenieurstudiums beschritten zu haben. Es kam vor, dass ich einige Male, am Ende der Woche mich von meinen Kollegen verabschiedete: »Das war es. Montag komme ich nicht wieder, ich bin doch nicht verrückt, meinen Geist so zu strapazieren, dass ich in der Klapsmühle lande«. Aber ich kam immer wieder!
Als wir eine Exkursion nach Berlin machten und in einer Unterkunft alle gemeinsam übernachteten, kam der Heimleiter auf mich zu, um mich als Semesterleiter zu begrüßen. Der wahre Semesterchef stand unmittelbar neben mir, dies nur zur KlarsteIlung meines Alters! Dann nahm ich auch Nachhilfestunden in der Mathematik, was zur Folge hatte, dass ich einigermaßen mitkam. Mittags aßen wir in einem Kaufhaus Tag für Tag und Woche für Woche immer den gleichen Fraß. Glitschiger Kartoffelsalat, ein halbes, blau gekochtes hartes Ei und eine sehr kleine, zähe Frikadelle. – Ich habe es überlebt! Es war aber billig, mehr Geld stand mir nicht zur Verfügung. Dann riet man mir, ich solle ein Stipendium beantragen, wurde von der ASTA aber abgelehnt, weil meine Durchschnittnoten eben unter der noch vertretbaren Grenze lagen. Als ich dann sagte, dass ich verheiratet sei und ein Kind hätte, wurde mir gesagt, dass das keinen Einfluss auf die Ablehnung hätte und nur »mein Bier« sei!! Diese Formulierung traf mich sehr hart, noch dazu sie von einem sehr viel Jüngeren mir gesagt wurde. Nachdem ich das Büro verlassen hatte, erkannte ich aber, dass es den Tatsachen entsprach und ich weiterhin zusehen musste, über die Runden zu kommen. Und tatsächlich kam ich über die Runden und erhielt für all meine Mühen und Entbehrungen mein Diplom zum Schiffsingenieur ausgehändigt.
Wenn ich noch heute an meine Studienzeit zurückdenke, so musste ich mich fast täglich mit neuen Schwierigkeiten auseinandersetzen.
Ein Fall hat sich besonders stark in meinem Gedächtnis verankert und genau diese Begebenheit hat mehr oder weniger auch mein späteres Leben beeinflusst. Wir hatten einen exzellenten Mathematiker als Dozent, den Herrn Dr. D., der in der glücklichen Lage war, Aufgaben so zu erklären, das man sie begriff und verstand. Dieser Dr. D. hatte eine Mathematik-Klassenarbeit angekündigt und durchblicken lassen, dass es sich um die Berechnung einer Brückenbaukonstruktion handeln würde. Einige Tage, nach dieser Ankündigung, war es so weit, und die Aufgabe lautete, die Tragkraft der Brücke zu ermitteln und die Auflagedrücke – bei Vollbelastung auf den Tragpfeilern – zu berechnen. Alle Daten waren gegeben, Dauer der Arbeit: 120 Minuten, verlassen des Raumes war verboten. Nachdem Dr. D. gefragt hatte, ob alles verstanden sei, gab er den Startschuss! Jeder war nun auf die Dauer von 120 Minuten auf sich allein gestellt. Erst fehlte mir der Anfang, aber dann kam ich gut ins »Rennen« und konnte sogar, noch vor der Zeit, meine Berechnungen abgeben.
Die nachfolgenden Diskussionen unter uns ergaben, dass die ermittelten Ergebnisse unserer »Experten«, mit meinem Resultat übereinstimmten. Nur?? Drei Tage später: Dr. D. verteilt die
Prüfungsblätter, auch ich bekomme meine Arbeit zurück. Fassungslos starre ich auf die Benotung. Eine Klare »6« (sechs), klar und überdeutlich steht der Kommentar vom Dr.: »Diese Brücke würde schon durch ihr Eigengewicht in die Tiefe stürzen!« Jegliches Gespräch mit Dr. D., ob berechtigt oder nicht, eine solche Note zu geben, endete mit folgender Bemerkung: »Wenn Sie den Wert eines kleinen Kommas nun richtig erkannt haben, werden Sie einsehen, dass die Note, 6 ihre Berechtigung hat! Sie haben sich nicht nur um eine KommasteIlung geirrt, sondern gleich um zwei Stellen und somit bleibt es bei meiner Benotung und noch eins, lieber Herr Hülsen, wie hätten Sie denn dagestanden, wenn ihnen ein solcher Fehler im Beruf passiert wäre? Unter Umständen wäre es sogar ein Fall für den Staatsanwalt geworden – sehen Sie es einmal so!!«
Diese Begebenheit mit Dr. D. nahm ich mir zu Herzen, da ich einsah, wie wichtig eine vermeintliche Kleinigkeit, ein kleines Komma sein kann!
Nun hatte ich den Lohn meiner Anstrengungen, was ich auch als meine Leidenszeit betrachtete, erhalten. Ich hatte das Studium erfolgreich abgeschlossen und war endlich frei. Lange vor den Endprüfungen hatte ich mich in die Hände eines Internisten begeben, der mir, nach und nach, meine innere Unruhe nahm und ich sehr gelassen, nach dem Motto – wird schon klar gehen – den zwei Prüfungswochen entgegen sah! Das »Schwarze Brett« der Schule füllte sich mit Angeboten der Reedereien, und es war kein Problem, eine passende Stelle auf einem Schiff zu bekommen. Da sich die Angebote aber fast nur auf 3. Ingenieure bezogen, so suchte ich eine Position als 2. Ingenieur, die mir die Lübecker Reederei Rud. Christ. Gribel anbot und ich danach auf S.S »KARL CHRISTIAN« als – Zweiter – in der Maschine anmusterte. Nach ca. zwei Monaten versetzte mich die Reederei auf die M.S. »POLCHOW«, wo ich für den 2. Ing. einspringen musste, der erkrankt war. Das Fahrgebiet dieses Schiffes sagte mir nicht zu. Mit Erdnüssen beladen, für die Margarineherstellung, fuhr das Schiff zwischen dem Senegal und Frankreich, hin und her! Und so kündigte ich meine Dienststelle, um zu einer der größten deutschen Reedereien – der Lübecker Schifffahrtsgesellschaft – Egon Oldendorff – zu wechseln…
Leseprobe:
...Mittags passieren wir ein Reedereischiff auf Gegenkurs, das M.S. »Erna Oldendorff«. Die Schiffe nähern sich so weit, dass man mit bloßen Augen die Personen erkennen kann. Wir haben einen Leichtmatrosen an Bord, dessen Vater auf dem anderen Schiff Kapitän ist und der seine Frau, die Mutter unseres Leichtmatrosen, mit an Bord hat. So begegnet sich die Familie auf hoher See. Ein paar Sätze, per Sprechfunk gewechselt und nach kurzer Zeit entschwinden die Schiffe in der Ferne – Seemannsschicksal! In Genua treffe ich zwei ehemalige Studienkollegen, die beide als 2. Ingenieure auf einem Turbinenschiff fahren, es wird ein sehr fröhlicher Abend bei mir an Bord. Dann erhalten wir Order nach Livorno zu gehen und dann weiter über Alicante nach Rotterdam, wo uns die Nachricht erreicht, dass wir für einige Reisen in der Holzfahrt eingesetzt werden und die erste Holzreise nach Leningrad geht. Bei der Passage des Nord-Ostsee-Kanals gibt es kurz vor Rendsburg einen kurzen Ruck und wir überlaufen irgendein Hindernis; sicher ein größerer, vollgesogener Baumstamm, den vielleicht ein anderes Schiff verloren hatte. Jedenfalls beschädigen wir uns den Propeller und wir können nicht mehr unsere Marschgeschwindigkeit halten. Außerdem rüttelt bei einer bestimmten Drehzahl das ganze Schiff und zwar so stark, dass unsere Positionslampe vom Vordermast nach unten kam. In der Ostsee machten wir zwei Knoten weniger Fahrt. Ende Mai gehen wir in Rotterdam in die Werft, um den Propeller richten zu lassen und ich fahre kurz entschlossen nach Hause, nach Kiel. Dann ist alles klar und wir gehen nach Finnland und mit Holz wieder zurück nach Rotterdam. Wir werden jetzt mehr in der Nord- und Ostseefahrt eingesetzt, kommen oft durch den Kanal und ich sehe meine Frau dadurch öfter, einige Male kam sie in Brunsbüttel an Bord. Um dann die Kanalpassage bis Kiel mit zu machen. Am 6 Juli habe ich wieder die Zusage von der Reederei, dass meine Frau wieder eine Reise mitmachen kann und so kommen sie in Holtenau an Bord. Über Antwerpen, Norwegen und wieder Kiel-Holtenau erhalte ich von der Reederei die Nachricht, dass mein Urlaub fällig ist und ich in der Schleuse abgelöst werde und so gehen wir gemeinsam in Holtenau von Bord...
Leseprobe:
Ich habe mich auf allen Schiffen der Reederei immer ausgesprochen wohl gefühlt und habe die Reederei nur großzügig und fortschrittlich kennen gelernt. Daher fiel mir meine Kündigung sehr schwer. Ich kündigte aus eigenemWunsch, um meine Auswanderung nach Amerika zu beschleunigen. Und hier hätte ich beinah einen Rückzieher gemacht, als mein Chef, der mich in Antwerpen persönlich verabschiedete, zu mir sagte: »Herr Hülsen, Sie sind so oft mit meinen Schiffen nach Amerika gekommen, wenn sie Fuß gefasst haben, dann veranlasse ich, dass auf einem meiner Schiffe Ihr gesamter Haushalt und wenn Sie wollen, auch Sie mit Ihrer Familie, natürlich ohne Kosten für Sie, nach den Staaten gebracht werden.« Da wurde mir erst so richtig klar, welche Wertschätzung ich bei der Reederei genoss! Aber es gab noch andere Gründe, mit allen Mitteln zu versuchen, meine Seefahrtzeit zu beenden. Die Patentinhaber, der 2. und der 3. Ingenieur, die man mir auf der letzten Fahrt an Bord geschickt hatte, waren nicht gerade arbeitswillig, tranken viel und vernachlässigten oft ihren Dienst. Hinzu kam, dass beide Herren nur eine stark eingeschränkte Vorstellung von der Verantwortlichkeit,als Wachingenieure hatten und ich mit ihren Leistungen und Benehmen in keiner Weise einverstanden war. Dann war da noch der Fall, wo ich einem Ing. Assistenten fristlos – wegen Arbeitsverweigerung – kündigte. Dieser Herr war vor das Arbeitsgericht in Hamburg gegangen, und ich musste mir, bei der späteren Verhandlung, vom Richter sagen lassen, dass ich wohl die Schuld tragen würde, denn als »kompetenter« Menschenführer hätte der Kläger sicherlich gerne und willig seine Arbeit an Bord gemacht! Das war zuviel für mich. Diese Entwicklung wollte ich nicht weiter mitmachen, und somit war meine Kündigung begründet. Am 12. Oktober 1963 begann mein längerer Urlaub, den ich auch dazu benutzen wollte, eine passende LandsteIlung zu finden!! Somit stand es für mich unumstößlich fest, dass das Kapitel »Seefahrt« sein Ende gefunden hatte und ich nun zusehen musste, an Land eine passende Stellung zu finden! Das war aber leichter gedacht als realisierbar. Ich sprach einige Firmen in Kiel an, leider ohne Erfolg.
Lesen Sie im Buch weiter!
|
Meine Postadresse / my adress / Los orden-dirección y la información extensa:
Jürgen Ruszkowski, Nagelshof 25,
D-22559 Hamburg-Rissen,
Telefon: 040-18 09 09 48 - Anrufbeantworter nach 30 Sekunden -
Fax: 040 - 18 09 09 54
Bestellungen am einfachsten unter Angabe Ihrer Anschrift per e-mail: Kontakt
|

|
zur gelben Zeitzeugen-Bücher-Reihe des Webmasters:
© Jürgen Ruszkowski

zur gelben Zeitzeugen-Bücher-Reihe des Webmasters:

Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks

Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 1 - Band 1 - Band 1
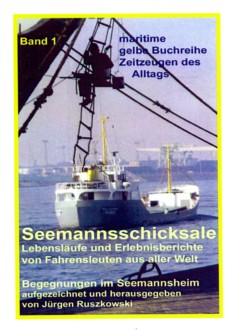
á 13,90 €
Bestellung
kindle- ebook für ca. 8 € bei amazon
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks-
B00AC87P4E
|
Band 2 - Band 2 - Band 2
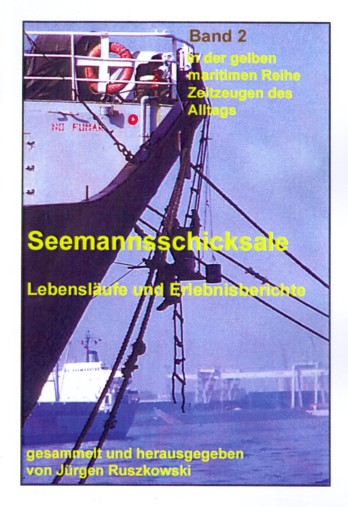
€ á 13,90
kindle-ebook für ca. 8 € bei amazon
auch als kindle-ebook bei amazon
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
B009B8HXX4
|
Band 3 - Band 3

á 13,90 € - Buch
auch als kindle-ebook bei amazon
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
nur noch bei amazon oder als ebook
B00998TCPS
|
|
Band 4 - Band 4 - Band 4
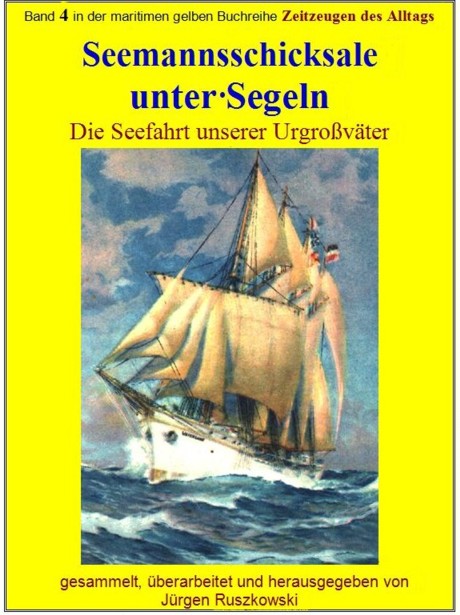
á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 5 - Band 5
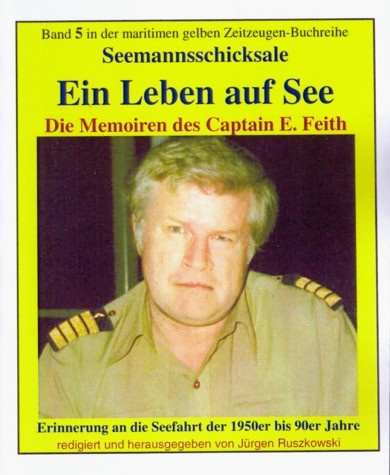
á 13,90 €
Bestellung
kindle-ebook für ca. 8 € bei amazon
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 6 - Band 6
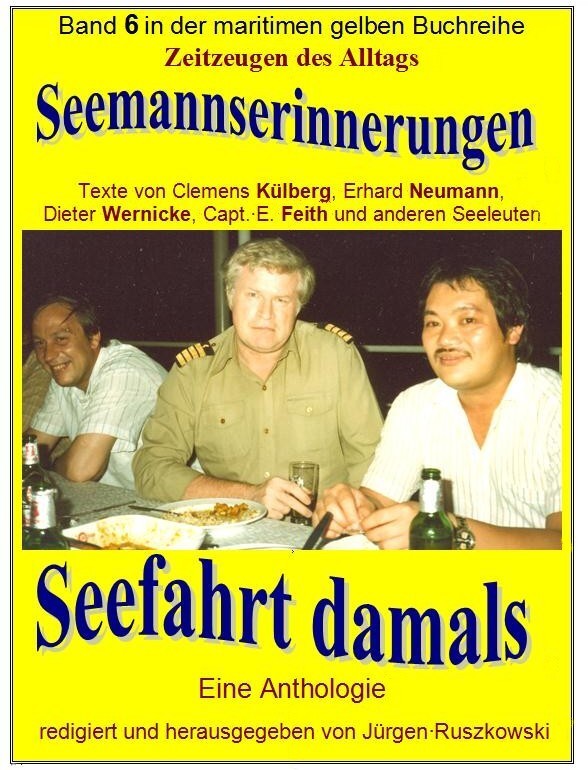
á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
|
Band 9 - Band 9
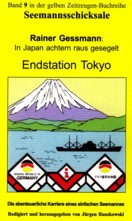
|
Band 10 - Band 10
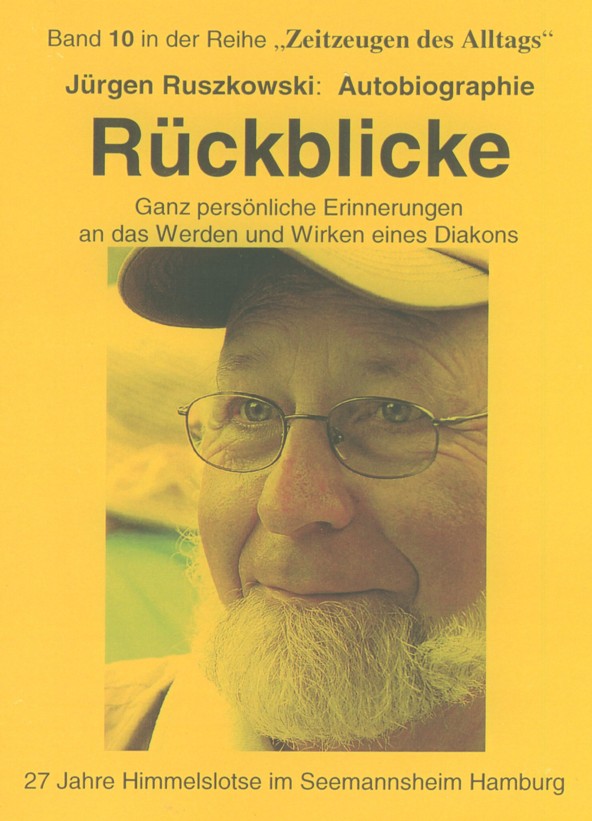
á 13,90 €
Bestellung
auch in mehreren Teilen bei amazon oder als ebooks
|
Band 11 - Band 11
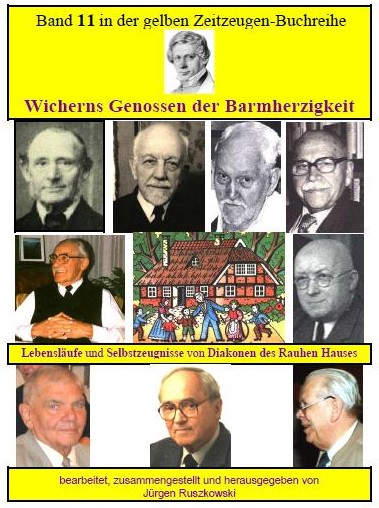
á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
|
Band 12 - Band 12

Diakon Karlheinz Franke
leicht gekürzt im Band 11 enthalten
|
Band 13 - Band 13
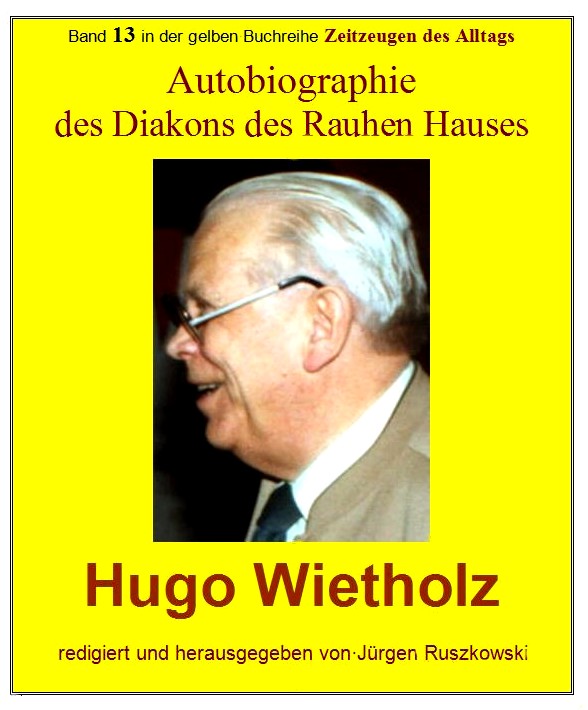
gekürzt im Band 11 enthalten
|
Band 14 - Band 14

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
|
Band 15 - Band 15
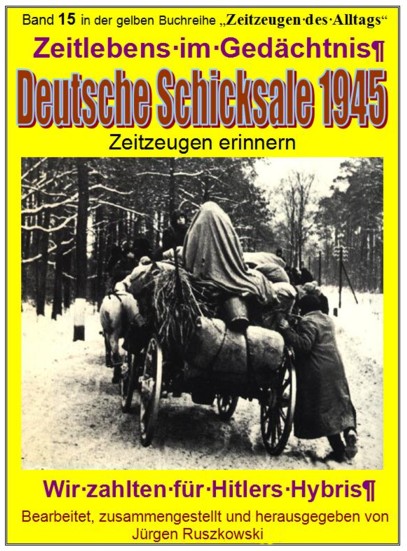
nur noch bei amazon oder als ebook
|
Band 17 - Band 17
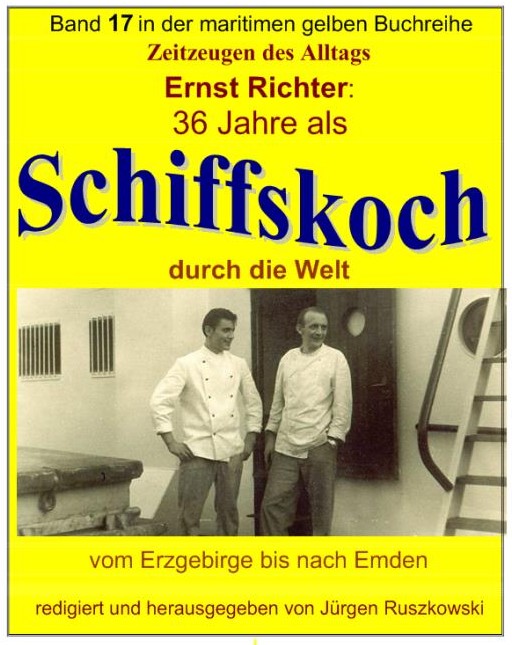
nur noch bei amazon oder als ebook
|
Band 18 - Band 18

nur noch bei amazon oder als ebook
|
|
Band 19 - Band 19

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 20 - Band 20
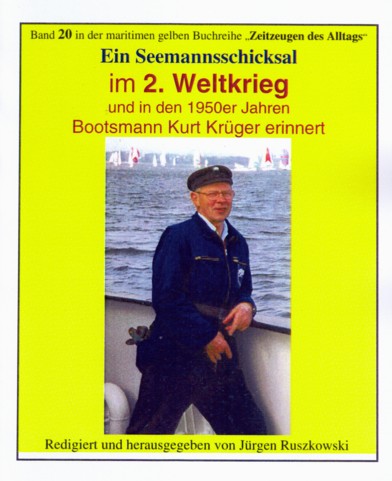
á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 21 - Band 21

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
|
Band 22 - Band 22

nur noch bei amazon oder als ebook
|
Band 23 - Band 23

Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 24 - Band 24
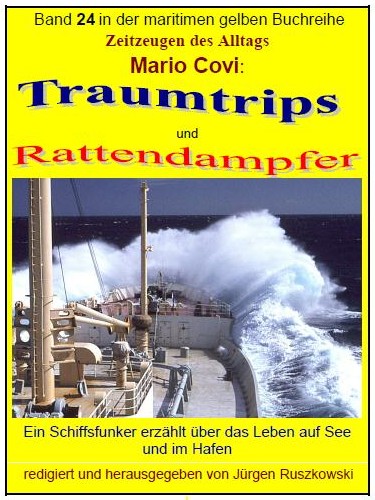
|
|
Band 25 - Band 25
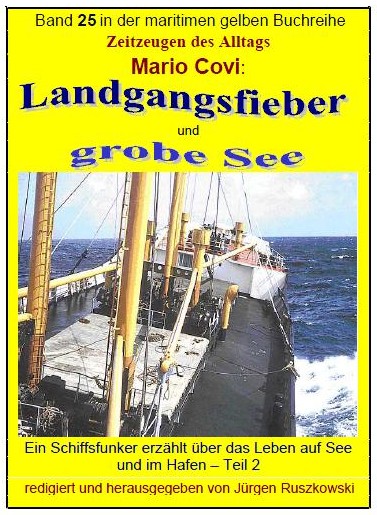
á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 26 - Band 26

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 27 - Band 27

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
|
Band 28 - Band 28

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 29 - Band 29
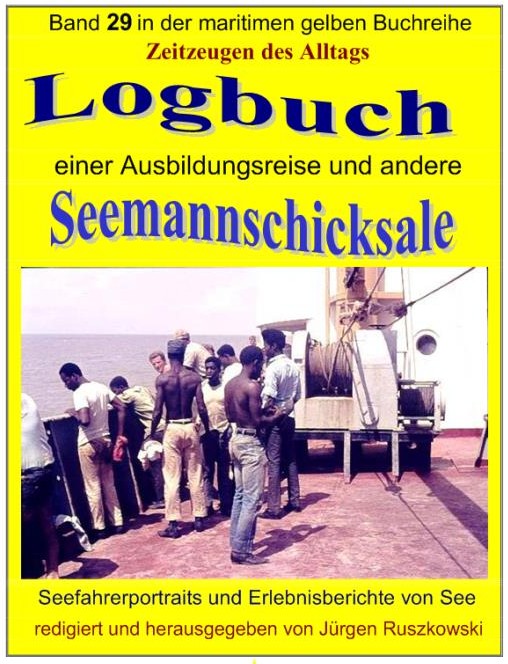
nur noch bei amazon oder als ebook
|
Band 30 - Band 30
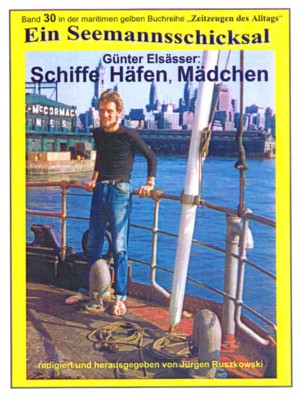
Reste á 13,90 € Bestellung
nur noch bei amazon oder als ebook
|
|
Band 31 - Band 31

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 32 - Band 32
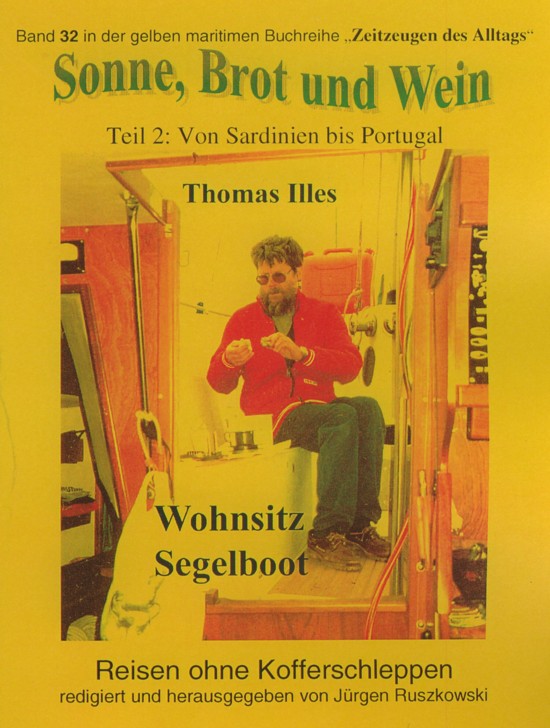
nur noch bei amazon oder als ebook
|
Band 33 - Band 33

nur noch bei amazon oder als ebook
|
|
Band 34 - Band 34

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 35 - Band 35

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 36 - Band 36

nur noch bei amazon oder als ebook
|
|
Band 37 - Band 37

Reste á 13,90 € Bestellung
nur noch bei amazon oder als ebook
|
Band 38 - Band 38

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 39 - Band 39
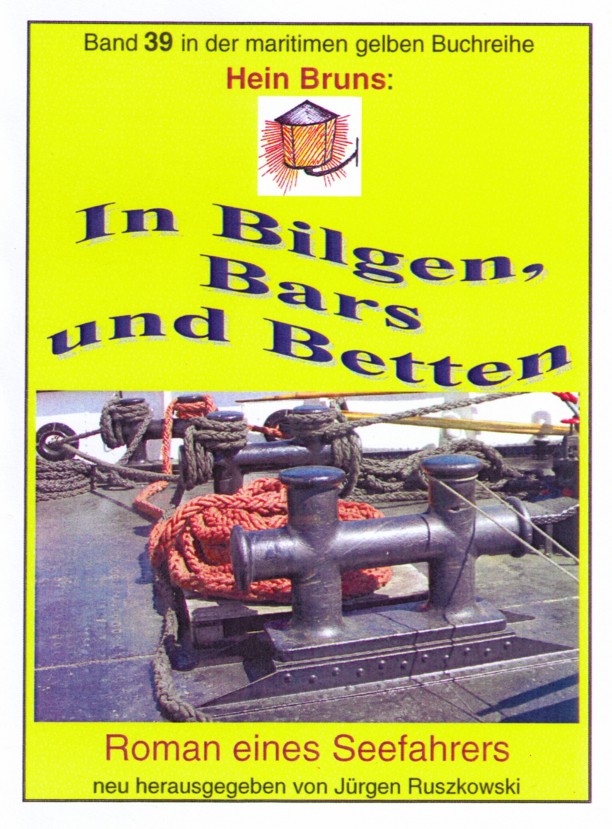
á 13,90 €
Bestellung
kindle-ebook für ca. 8 € bei amazon
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
|
Band 40 - Band 40

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 41 - Band 41

Reste á 13,90 € Bestellung
nur noch bei amazon oder als ebook
|
Band 42 - Band 42

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
|
Band 43 - Band 43 - Band 43

Bestellung
kindle-ebook für ca. 5 € bei amazon
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 44 - Band 44 - Band 44

Reste á 13,90 € Bestellung
nur noch bei amazon oder als ebook
|
Band 45 - Band 45 - Band 45
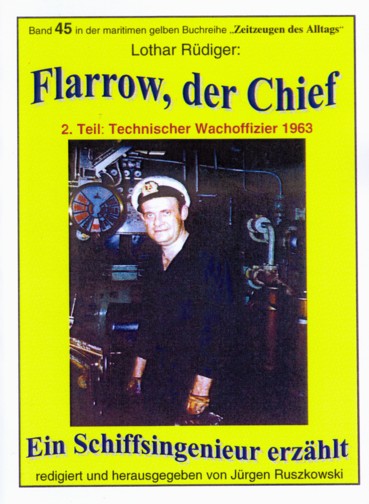
á 13,90 €
Bestellung
kindle -ebook für ca. 8 € bei amazon
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
|
Band 46 - Band 46 - Band 46
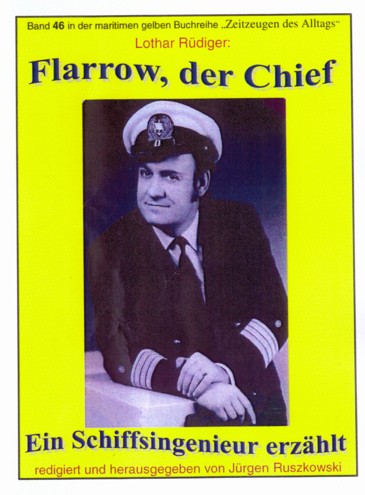
Reste á 13,90 € Bestellung
nur noch bei amazon oder als ebook
|
Band 47 - Band 47 - Band 47

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 48 - Band 48

nur noch bei amazon oder als ebook
|
|
Band 49 - Band 49 - Band 49

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 50 - Band 50 - Band 50

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
. Band 51 - Band 51 - Band 51

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
|
Band 52 - Band 52

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 53 - Band 53

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 54 - Band 54
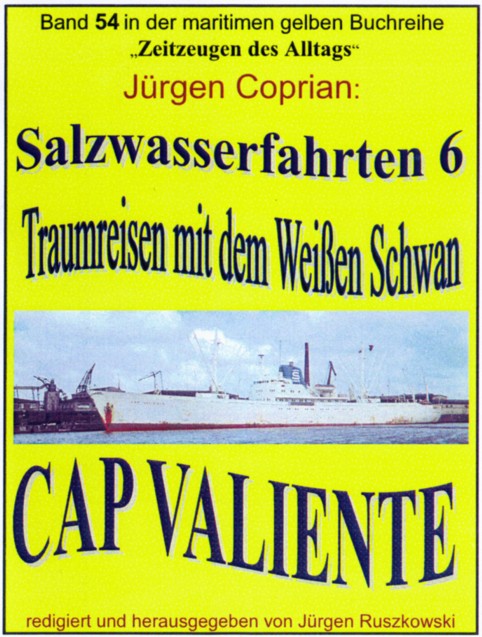
á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
|
weitere Bände sind geplant
|
Band 56 - Band 56

nicht mehr lieferbar
k
|
Band 57 - Band 57 - Band 57

nicht mehr lieferbar
|
|
Band 58 - Band 58 - Band 58

á 13,90 €
Bestellung
nur noch bei amazon oder als ebook
|
Band 59 - Band 59

nur noch bei amazon oder als ebook
|
Band 60 - Band 60
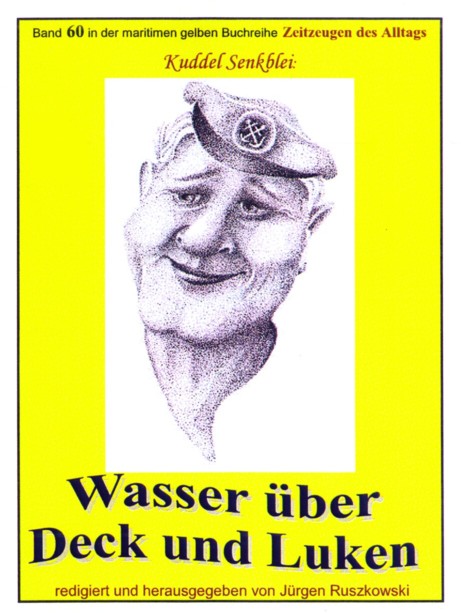
á 13,90 €
Bestellung
kindle-ebook für ca. 8 € bei amazon
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
|
Band 61 - Band 61
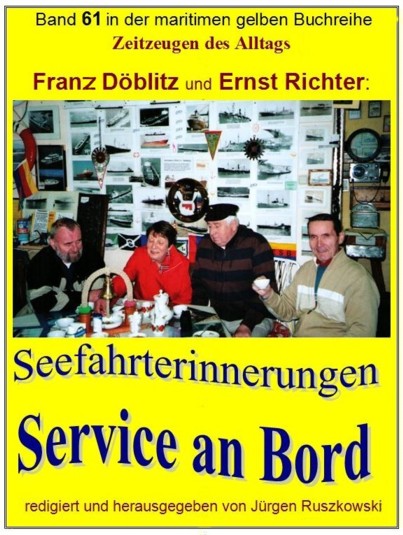
á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 62 - Band 62

á 13,90 €
Bestellung
kindle-ebook für ca. 8 € bei amazon
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
- Band 63 - Band 63 -

hier könnte Ihr Buch stehen
|
|
Band 64 -

á 13,90 €
Bestellung
- kindle-ebook -
|
Band 65 - Band 65 - Band 65 -
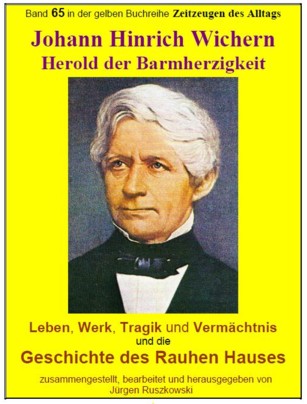
Johann Hinrich Wichern
Reste á 13,90 €
Bestellung
auch in mehreren Teilen bei amazon oder als ebook
hier könnte Ihr Buch stehen
|
- Band 66 - Band 66 - Band 66
Bernhard Schlörit:
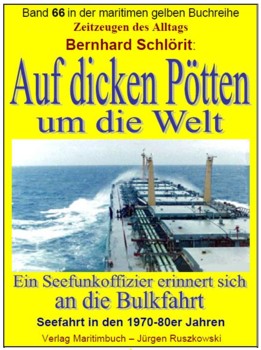
- Auf dicken Pötten um die Welt -
á 13,90 €
Bestellung
|
|
- Band 67 - Band 67 -

Schiffsjunge 1948-50
á 13,90 €
Bestellung
kindle-ebook bei amazon
für 7,60 € oder 10,29 US$
|
Band 68 - Band 68 -
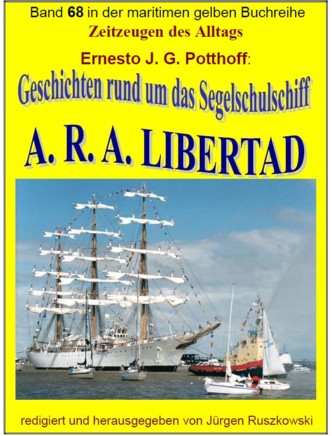
Ernesto Potthoff:
Segelschulschiff LIBERTAD
f0r 7,60 € oder 10,29 US$
|
Band 69 -

Ernst Steininger:
á 13,90 €
Bestellung
ebbok für 7,49 € oder 10,29 US$
hier könnte Ihr Buch stehen
alle Bücher ansehen!
|
je Buch 13,90 € innerhalb Deutschlands portofrei gegen Rechnung - Bestellungen
Buchbestellungen
Kontaktformular
Bestellung
Gesamtübersicht über viele Unterseiten auf einen Blick
weitere websites des Webmasters:
Diese website existiert seit dem 7.02.2011 - last update - Letzte Änderung 21.06.2018
Jürgen Ruszkowski © Jürgen Ruszkowski © Jürgen Ruszkowski
|

