 |
|
Die Memoiren des Capt. E. Feith
Erinnerungen an die Seefahrt der 1950er bis 90er Jahre - Band 5 in der Reihe Seemannsschicksale
Erster Teil: Vor dem Mast
|

|
Datenschutzerklärung
Lesen Sie diesen Text bequemer in Buchform:
Band 5 aus der gelben Buchreihe "Zeitzeugen des Alltags" von Jürgen Ruszkowski

direkt beim Herausgeber für 13,90 € bestellen.
Viele Bände sind jetzt auch als amazon-Direktdruck-Printbücher zu erhalten:
Band 1 - Band 2 - Band 4-1 Alfred Tetens - Band 4-b Anthologie 2015 - Band 5 - Band 6 - Band 15 = neu bearbeitet - Band 17 = neu bearbeitet - Band 18 = neu bearbeitet - Band 19 - Band 20 - Band 21 - Band 22 - Band 26 - Band 27 - Band 30 - Band 31 - Band 32 - Band 33 - Band 36 - Band 37 - Band 39 - Band 40 - Band 41 - Band 42 - Band 43 - Band 44 - Band 45 - Band 46 - Band 47 = neu bearbeitet - Band 48 - Band 58 - Band 59 - Band 60 - Band 64 - Band 65 - Band 68 - Band 69 - Band 70 - Band 71 - Band 73 - Band 76 - Band 78 - Band 79 -
auch als kindle-ebook für ca. 8 € bei amazon oder als neobooks-ePub-ebook
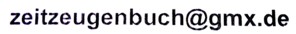
Vom Kümo-Moses bis zum Kapitän auf Großer Fahrt

Capt. E. Feith verstarb 1912
1.Teil: Vor dem Mast zum 2. Teil: Matrose zum 3. Teil: Hinter dem Mast
Der mittesechzigjährige (bis zur Veröffentlichung des Buches) immer noch aktive Kapitän E. Feith wirkt auf den ersten Blick unauffällig und eher etwas spröde, entpuppt sich bei näherem Hinsehen aber schnell als ein mit allen Wassern der Weltmeere gewaschenes interessantes Multitalent. Mit Blick auf eine Parkanlage an der Grenze zwischen den Hamburger Stadtteilen Ottensen und Othmarschen residiert er in einer schönen gutbürgerlichen Altbauwohnung in der Nähe der Elbchaussee mit Frau und Tochter, wenn er nicht gerade mit seinem Schiff auf hoher See unterwegs ist. Seine Wohnung hat er mit vielen Souvenirs aus aller Welt und mit einer Reihe selbstgemalter Kapitänsbilder - in Öl gemalte Segelschiffe - dekoriert. Stolz zeigt er ein liebevoll und mit Sorgfalt gestaltetes Fotoalbum mit interessanten alten Schwarzweißphotographien aus seiner seemännischen Laufbahn in den 1950er und 60er Jahren. Den ersten Teil seiner aufschlussreichen Memoiren vom Aufstieg aus den Anfängen als Moses bis zur verantwortlichen Tätigkeit als 1.Nautischer Offizier und einige Erlebnisse als Kapitän hat er bereits unterwegs an Bord in die Schreibmaschine getippt und dabei seine regelmäßigen fleißigen Eintragungen ins Tagebuch ausgewertet. Die Schilderung der vielen weiteren Erlebnisse seiner über 30jährigen Fahrzeit als Kapitän, werden folgen, wenn er endgültig das Ruder aus der Hand gegeben haben wird. Aber noch mag er nicht ins Altenteil hinüberwechseln. Captain E. Feith berichtet:
Herkunft und Kindheit
„Ich wurde am 22. November 1936 in Reval geboren. Mein Vater war Diplomingenieur für Hoch- und Tiefbau. Er hatte meine Mutter auf der estnischen Universität in Dorpat kennen gelernt und im Jahr meiner Geburt geheiratet. Natürlich musste meine Mutter das Studium unter den Bedingungen jener Zeit abbrechen und sich nach den damaligen Moralvorstellungen ganz auf Mutterpflichten umstellen. Die Hochzeit meiner Eltern soll gewaltig gewesen sein und eine Woche lang gedauert haben. Da mein Großvater mütterlicherseits ein angesehener Fischer war, hatte sein ganzes Dorf daran teilgenommen. Mein Großvater väterlicherseits war ein christlich getaufter bekannter und begüterter Lederfabrikant „nicht arischer“ Herkunft.
Ein Jahr nach meiner Geburt erkrankte meine Mutter während eines Besuches in ihrem Heimatdorf an einer schweren Nierenbeckenentzündung. Das war zur Winterzeit, und ein Schneesturm mit Straßenverwehungen verhinderte rechtzeitige ärztliche Hilfe, so dass meine Mutter verstarb. Mein Vater heiratete nicht wieder und überließ meine Erziehung meinen Großeltern väterlicherseits, die für mich ein Kindermädchen einstellten, an das ich mich nicht mehr erinnern kann. Mit fünf Jahren bekam ich eine Gouvernante, eine hübsche, schlanke, dunkelhaarige Endzwanzigerin, die mich in deutscher Sprache, Mathematik und weiteren Fertigkeiten unterrichtete. Sie wohnte bei uns, und so war ich fast immer mit ihr zusammen, und wir mochten uns sehr.
Meinen Vater sah ich nur am Wochenende, da er in Dorpat ein eigenes Haus und Ingenieurbüro hatte und sehr beschäftigt war. Meine Großeltern waren schon über 60 Jahre alt und während sich mein Großvater tagsüber um seine Fabrik und andere Geschäfte - er war an einigen weiteren Firmen beteiligt - kümmerte, hielt sich meine Großmutter meist im Hause auf. Sie stammte aus Düsseldorf, war eine geborene Thyssen und weitläufig mit der Stahldynastie verwandt. Großmutter war sehr streng. Ich habe sie selten lächeln gesehen und musste sie mit „Sie“ anreden. Vom Hauspersonal wurde sie respektiert und gefürchtet. Sie gab sich unnahbar, besaß jedoch ein weiches Herz, was sie zu verbergen suchte.
Nach dem Hitler-Stalin-Pakt erlebten wir 1940 den Einmarsch der Sowjets und 1941 die „Befreiung“ durch die deutsche Wehrmacht während des Russlandfeldzuges. Als nicht arischer Deutscher, der noch vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Reich nach Dorpat emigriert war, musste mein Großvater als ehemaliger deutscher Weltkriegsmajor einen „Schutzengel“ bei der Wehrmacht gehabt haben, denn man ließ ihn in Ruhe und zog sogar meinen Vater zum Wehrdienst ein und schützte ihn durch ständige Versetzungen vor dem Zugriff der Gestapo. Vermutlich hielten alte Regimentskameraden ihre schützende Hand über meinen Großvater.
Ende 1943 rückten die Russen immer näher, und die Deutschen mussten der Übermacht weichen. Da mein Großvater in Deutschland als Nichtarier nichts Gutes zu erwarten hatte, schickte er mich mit einem Major der Abwehr zu meiner Tante nach Gotenhafen. Er selber blieb zurück, hatte aber unter den Sowjets keine bessere Perspektive als bei den Faschisten und wurde nach dem Einmarsch der Roten Armee als „Kapitalist“ und „Ausbeuter“ nach Sibirien deportiert, wo er 1948 verstarb. Meine Großmutter folgte ihm ein Jahr später. Die Tante in Gotenhafen, die mich zuletzt als dreijähriges Kleinkind gesehen hatte und an die ich mich nicht mehr erinnern konnte, war nicht gerade begeistert, als plötzlich ein siebenjähriger Junge vor ihrer Tür stand. Sie war eine hochgeistige und sensible Dame, die in Wien Musik studiert hatte. Sie sah in mir einen sanften Wiener Sängerknaben oder gar eine Miniaturausgabe von Mozart. Dem entsprach ich jedoch in keiner Weise. Im Gegenteil war ich das, was man einen Lausbuben nennt. So war unser Verhältnis immer ein sehr gespanntes und ich hatte stets das Gefühl, für sie eine ungeliebte Belastung zu sein.
Ich kann mich nicht erinnern, dass sie mich je einmal in den Arm genommen oder mir einen Kuss gegeben hätte. Ihr fehlte überhaupt das Gefühl für Kinder und jeder mütterliche Instinkt. Trotzdem muss ich ihr anrechnen, dass sie überhaupt diese Belastung meiner Pflege auf sich genommen hat. Nach einer abenteuerlichen Flucht vor den Russen über Hela und Internierung in Dänemark landeten wir 1948 in Weilheim in Oberbayern in der amerikanischen Zone. Wenn ich meiner Tante zu einer zu großen Plage wurde, war sie manchmal drauf und dran, mich in ein Waisenhaus zu geben, zumal mein Vater 1944 als vermisst gemeldet wurde und ich somit als Vollwaise gelten konnte. In späterer Jahren wurde das Verhältnis zwischen meiner Tante und mir ein sehr herzliches und besteht bis heute. Schon früh entwickelte sich in mir der Wunsch, zur See fahren zu wollen. Nach dem Abschluss der Grundschule, welche ich mit dem zweitbesten Zeugnis meiner Klasse verließ, begann meine Laufbahn zur See.
Ich will zur See fahren
Als ich 1952 sechzehnjährig auf dem Bahnsteig von Weilheim im tiefsten Oberbayern mit Strickjacke, Seppelhut und billigem Pappkoffer vor meinem Zug in Richtung Hamburg stand, fiel der Abschied von meiner Tante entsprechend kühl aus, denn viel Zuneigung und familiäre Bindungen hatte es zwischen ihr und mir nie gegeben. Das Letzte, das ich von Weilheim sah, waren meine Tante und ihr Lebensgefährte, die mir mit einem Taschentuch nachwinkten. Ich sollte meine Tante erst acht Jahre später wiedersehen. Warum ich damals zur See fahren wollte, habe ich eigentlich nie begriffen. Schon mit 14 hatte mein Entschluss festgestanden, Seemann zu werden. Vielleicht hat das Erbteil meiner so früh verstorbenen Mutter eine Rolle gespielt, da die Familie ihres Vaters seit Generationen der Fischerei nachging. Großvater und seine Söhne, meine Onkel, fuhren aufs Meer hinaus.
Nun reiste ich als Halbwüchsiger alleine quer durch Deutschland gen Hamburg, allerdings nicht ganz alleine, denn der Vater eines Schulfreundes begleitete mich. Er war Lokomotivführer und hatte zufällig eine Dienstreise nach Hamburg zu machen, um von dort einen Zug nach Bayern zurückzuführen. Wir erreichten Hamburg, das „Tor zur Welt“ nach einer langen Nachtfahrt. Es war der 20. Mai 1952. Ich verabschiedete mich von meinem älteren Reisebegleiter, der gegen Mittag seinen Zug zurück nach München bringen sollte und stand nun mutterseelenallein mit meinem Pappkoffer auf dem riesigen Weltstadtbahnhof. Jetzt war ich also das erste Mal in meinem Leben ganz auf mich allein gestellt. Meine ganze Barschaft betrug 27 Mark.
Laut Instruktion sollte ich mich nach meiner Ankunft zum Arbeitsamt begeben und mich dort bei einem Kapitän Kegck melden. Nach vielen Fragen fand ich den Weg dorthin zu Fuß, denn es war nicht weit entfernt vom Bahnhof. Dieser Kapitän Kegck war der erste leibhaftige Kapitän, den ich zu sehen bekam und meine Ehrfurcht vor ihm war groß. Nach einigen Ratschlägen und Tipps verwies er mich zum Seemannsheim der Deutschen Seemannsmission in der Großen Elbstraße 132 in Altona, wo ich mich beim Hausvater zu melden hätte. Dort sollte ich bis zur Anmusterung wohnen. Hamburg ist groß und es war das erste Mal, dass ich alleine in der Großstadt war. Nach einer Irrfahrt mit der Straßenbahn und einem längeren Fußweg erreichte ich schließlich doch mein Ziel. Das Seemannsheim war ein großes im Jahre 1930 gebautes mehrstöckiges Backsteingebäude direkt am Elbufer mit herrlichem Blick über das Hafengelände beim Altonaer Fischmarkt, das den Krieg zwar nicht ganz unbeschadet, aber doch überstanden hatte und seit 1950 auch als Schiffsjungenheim diente. Das Seemannsheim beherbergte eine größere Zahl abgemusterter und zur Zeit arbeitsloser Seeleute jeglichen Alters und Dienstranges. Ich kam zu einer Gruppe fast gleichaltriger Schiffsjungen, die wie ich als Moses auf irgendeinem Schiff anfangen wollten. Der Schiffsjunge wurde an Bord nach alter Tradition Moses genannt, weil der aus dem alten Ägypten stammende Führer des Volkes Israel als Kleinkind in einem Schilfkörbchen auf dem Nil schwimmend als jüngster Fahrensmann galt.
Die angehenden Schiffsjungen lebten im Seemannsheim in 4- oder 6-Bett-Zimmern, und für uns Jugendliche galten besondere dem Jugendschutz angepasste Hausvorschriften: Wir durften nicht rauchen und mussten bis 22 Uhr zurück im Hause sein. Zuwiderhandlungen konnte mit Rausschmiss oder Sperrung für den Seemannsberuf geahndet werden. Wir Moses-Aspiranten unterstanden einem altgedienten und erfahrenen Bootsmann, der uns „Seemannschaft“ beibringen sollte. Er sorge dafür, dass unser Tag voll ausgefüllt war und wir nicht auf dumme Gedanken kommen konnten: Nach dem Frühstück bekamen wir erst einmal theoretischen Unterricht. Da die meisten von uns noch nie ein Schiff betreten oder von innen gesehen hatten, wurden uns erst einmal Begriffe wie „Steven“, „achtern“, „Backbord“ oder „Steuerbord“ erklärt. Außerdem marschierte jeden zweiten Tag ein Teil von uns mit unserem Bootsmann zur Hafenstraße an die Anlegestelle der „Fähre 7“. Dort lag die Dreimastbark „Seute Deern“ - heute Attraktion im Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven - als Restaurantschiff vertäut. Mit ihrem großen Marinerettungsboot lernten wir das „Pullen“, wie das Rudern seemännisch heißt.
Unser Bootsmann war ein harter Lehrmeister, der uns nicht schonte und uns immer wieder einbläute, dass später an Bord bei Seenot unser Leben von einer richtigen Grundausbildung abhängen würde. Wir lernten alle Bootskommandos und ruderten auf der Elbe gnadenlos vier bis fünf Stunden gegen oder mit dem Strom. Wer aus dem Takt kam, erhielt eins mit dem Tampenende übergezogen. Die ersten Tage hatten wir alle einen furchtbaren Muskelkater, Blasen an den Händen und ließen uns abends todmüde ins Bett fallen. Manchmal pullten wir zu den Bananenschuppen hinüber, wo die Fruchtschiffe lagen. Dann gab es für uns eine große Staude überreifer Südfrüchte, die für den Handel nicht mehr geeignet waren. Wir verputzten sie in Rekordzeit. Ich habe selten in meinem späteren Leben, auch als Kapitän, einen so ausgeglichenen und hervorragenden Seemann kennen gelernt wie unseren damaligen Bootsmann. Er war der geborene Lehrmeister. Wenn wir etwas von der Seemannschaft gelernt haben, so verdanken wir es ihm, auch dass wir nicht so ganz unwissend als Moses an Bord kamen. In dieser kurzen Zeit von sechs Wochen hat er uns mehr beigebracht, als ich später an Bord je an Knoten und Tauspleißen lernen konnte.
Zwischendurch machten wir bei der SBG (Seeberufsgenossenschaft) unser Seetauglichkeitszeugnis, welches Voraussetzung für die Ausstellung des Seefahrtbuches war. Wir wurden so gründlich, wie es nur möglich war, untersucht und es gab keine Stelle am Körper, die ausgelassen wurde. Wer den Gesundheitstest nicht bestand, konnte gleich nach Hause gehen. Wenn es die Augen waren, konnte er die Maschinen- oder Bedienungslaufbahn einschlagen. Der erhebendste Augenblick war die Aushändigung des Seefahrtbuches. Jetzt war man ja schon ein „beginnender Seemann“. Mit dem Besitz des Seefahrtbuches traten auch einige besondere gesetzliche Bestimmungen in Kraft. Während man an Land damals erst mit 21 Jahren volljährig wurde, war man als Seemann unter 21 Jahren beschränkt volljährig. Man konnte im Gegensatz zu einem minderjährigen Lehrling an Land seinen Arbeitsvertrag, den Heuerschein, ohne Einwilligung des Erziehungsberechtigten selbst unterschreiben und auf einem Schiff anmustern oder auch später abmustern.
An Bord galt allerdings auch das Jugendschutzgesetz mit einigen Einschränkungen, was die Arbeitszeit anbetraf. So konnten Jugendliche auch an Sonn- und Feiertagen eine gewisse Stundenzahl beschäftigt werden, da der Bordbetrieb besondere Regelungen erforderte. Gewisse Arbeiten, wie das Trimmen der Ladung im Hafen, Arbeiten im Mast usw. durften von Jugendliche nicht ausgeführt werden. Nur wenn die Sicherheit des Schiffes gefährdet war, konnte von diesen gesetzlichen Einschränkungen abgewichen werden. Der Begriff „Sicherheit des Schiffes“ war offenbar dehnbar, und oftmals wurden in der Praxis unter diesem Motto gesetzliche Vorschriften umgangen. Besonders in der Küstenschifffahrt nutzte man die Schiffsjungen unter Umgehung der Schutzvorschriften bis zur Erschöpfung aus. Die Arbeitszeitvorschriften wurden nach meiner späteren Borderfahrung nie eingehalten. Die Vorgesetzten hatten auch dafür zu sorgen, das Alkoholkonsum- und Rauchverbot für Jugendliche durchzusetzen und darauf zu achten, dass diese im Hafen bis 22 Uhr vom Landgang an Bord zurück waren. Auch hier sah die Praxis anders aus. Aber davon später, denn bisher waren wir ja immer noch im Seemannsheim.
In unserer knappen Freizeit und besonders an Sonntagen, an denen wir frei hatten, gingen wir in kleinen Gruppen am Hafen oder auf der Reeperbahn spazieren. Das war für die meisten von uns eine neue unbekannte Welt, besonders das Vergnügungsviertel von St. Pauli mit seinen Kaschemmen, Kneipen, Nachtbars, Straßennutten und Bordellen. Wir kamen uns vor, wie „Alice im Wunderland“ und brauchten einige Zeit, um dies alles zu verdauen. Viele von uns ließen sich, um ja als Seemann zu gelten, für sechs Mark einen Anker auf den Unterarm tätowieren, den man dann stolz bei halb aufgekrempeltem Ärmel zur Schau stellte. Mit großen Augen bestaunten wir die abenteuerlich aufgetakelten Huren in der Herbertstraße, die vor ihren Fenstern saßen und die Freier animierten. Es gab sie so ganz in Leder mit Peitsche oder als „Salome“, und die ganz freizügigen hielten nur ihren Venusberg bedeckt. Die Preise waren natürlich den Ansprüchen gemäß gestaffelt. Die einfache „Nummer“ kostete damals fünf Mark. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass einer von uns zu einer reingegangen ist. Schüchternheit oder fehlender Mut überwogen. Die Damen wussten natürlich mit erfahrenem Blick, wie unbedarft wir waren und entsprechend fielen ihre Bemerkungen und Kommentare aus.
Neben unserem Seemannsheim befand sich ein großes Seemannsausrüstungsgeschäft, und wir wunderten uns, was man als Seemann an Bord so alles an Kleidung brauchte. Es gab dort Seesäcke, Takelhosen, Pudelmützen, Ölzeug und Pullover, um nur einiges zu nennen. Da wir alle kein Geld hatten, waren wir natürlich nicht in der Lage, uns etwas zu kaufen. Unser Bootsmann gab uns den Rat, erst mal an Bord zu gehen. Dort würde sich schon alles regeln, man würde dann schon selbst sehen, was man brauche. Wenn ich damals bereits gewusst hätte, dass man sein eigenes Bettzeug an Bord mitbringen muss, hätte ich mir zumindest für mein letztes Geld eine billige Wolldecke gekauft, denn diesen Mangel habe ich später bitter zu spüren bekommen.
Vor dem Mast
Moses auf dem Kümo „RÜGEN“
Eines Morgens musste ich mich bei unserem Hausvater melden, der mir mitteilte, dass ich sofort zu der Schiffsagentur Thode gehen sollte, da ein Kümo (Küstenmotorschiff) einen Schiffsjungen suchen würde. Auch bestehe die Möglichkeit, dass ich schon am folgenden Tag an Bord gehen müsse. Die Agentur Thode, eine altehrwürdige Hamburger Firma, hatte ihr Kontorgebäude gleich um die Ecke, und eine Stunde später hatte ich bereits meinen Heuerschein für das Kümo „Rügen“ und eine Fahrkarte nach Kiel in der Tasche, außerdem fünf Mark für Spesen. Mein Schiff sollte im Laufe des nächsten Tages in die Holtenauer Schleuse einlaufen und dann weiter in die Ostsee nach Finnland gehen. Ich hätte mich am folgenden Morgen an der Kanalschleuse bei der Schiffsagentur Zerssen & Co, die bereits unterrichtet wäre, zu melden. Das Motorschiff „Rügen“ sei ein Kümo von ca. 500 Ladetonnen und gehe in Ballast nach Finnland, wo es Schnittholz laden solle. Man nannte die Kümos damals allgemein „Arschbackenkreuzer“, ein Ausdruck, der in der ganzen deutschen Seefahrt geläufig war. Die Schiffsführung bestand allgemein aus dem Kapitän und einem Steuermann mit kleinem „Küstenbefähigungszeugnis“, auch „Kleines Patent“ genannt, welches den Inhabern erlaubte, in der Nord- und Ostsee herumzuschippern. Als Besatzung waren in der Regel vier Mann vorgeschrieben, wovon einer ein Vollgrad (Vollmatrose) sein musste.
Es war ein schöner sonniger Julimorgen, als ich an der Schleuse Holtenau stand und bangen Herzens auf mein Schiff wartete. Da es noch nicht gemeldet war, hatte ich meinen Pappkoffer bei der Agentur Zerssen & Co abgestellt und beobachtete die in die Schleusen ein- und auslaufenden Schiffe. Sie kamen entweder aus der Ostsee, um durch den Kanal in die Elbe und Nordsee zu gelangen, oder sie verließen den Kanal in Richtung Ostsee. Vom Kümo bis zum großen 15.000-Tonner machten sie in den Schleusen fest und ich beobachtete, wie die Besatzungen auf dem Vorschiff und dem Heck die Schiffsleinen an Land gaben oder beim Ablegen einholten. Ich kam ins Träumen und stellte mir schon vor, dass ich selbst bald auf dem Vorschiff oder am Heck stehen würde, um als wichtiges Rädchen im Bordbetrieb die Befehle des Kapitäns zu befolgen.
Gegen Mittag wurde bei der Agentur die Ankunft des M/S „Rügen“ für den nächsten Schleusendurchgang gemeldet, und ich machte mich zusammen mit dem Vertreter der Agentur auf den Weg zur Schleusenkammer. Das erste Schiff, ein großer Finne, machte gerade fest, dem einige andere mittelgroße Frachter folgten. Da die Schleuse schon voll besetzt schien und mein Schiff nicht darunter war, wollten wir schon zurückgehen, bis sich doch noch ein „Winzling“ von Kümo in die Schleusenkammer schob und hinter dem letzten Frachter festmachte. Der Name „Rügen“ prangte in übergroßen weißen Lettern an den beiden Seiten des Bugs und hätte einem Ozeanriesen zu Ehren gereicht. Mein Schiff war angekommen! Wir stiegen an einer langen Holzleiter hinab an Deck und meldeten uns beim Kapitän. Nachdem der Agent den Messbrief eingesehen hatte, schickte mich der Kapitän nach einer kurzen Begrüßung ins Mannschaftslogis unter die Back (Steven unter dem Vordeck). Kurz darauf lief die „Rügen“ aus der Schleuse in die Ostsee Richtung Finnland und ich hatte Gelegenheit, meine zukünftigen Bordkameraden und unsere Unterkunft kennen zu lernen.
Wir hausten, anders kann man es nicht nennen, zu viert unter der Back in einem Massenlogis ganz vorne am Steven (Bug) des Schiffes. Wir: das waren ein Leichtmatrose, ein Jungmann ein befahrener Moses und ich der unbefahrene Neuling. Der Leichtmatrose hieß Günther und war schon 32 Jahre alt. Der Jungmann, Manfred, war 19 Jahre und kam aus Hamburg. Den Namen des befahrenen Moses habe ich vergessen, weiß aber, dass er nach dieser Reise Jungmann werden sollte und da wir bereits einen solchen hatten, abmustern wollte. Eigentlich war ein Matrose vorgeschrieben, aber dessen höhere Heuer wollte der Eigner sparen. Bekam er Schwierigkeiten mit den Behörden, fuhr der Eigner, der ein Kapitänspatent besaß, bis zum nächsten ausländischen Hafen als Kapitän, der angeheuerte Kapitän wurde solange Steuermann und der Steuermann derweil „Bestmann“, was dem Bootsmann auf großen Schiffen entsprach. Im nächsten ausländischen Hafen oder auch schon kurz vor Auslaufen, wenn die Behördenvertreter das Schiff verlassen hatten, ging der Eigner von Bord, und alles lief wie vorher gehabt. Musste aber wirklich mal ein Matrose gefahren werden, wurde dafür gesorgt, dass er nach einer Reise wieder von Bord ging. Aber davon später mehr.
Die Autoritätsperson unter der Back war Günther, der Leichtmatrose, da er den höchsten Rang hatte und der älteste unter uns war. Er hatte schon eine bewegte Vergangenheit hinter sich. Während des 2. Weltkrieges hatte er von Anfang an bei der Kriegsmarine gedient und nach Kriegsende Maler gelernt. Nach der abgeschlossenen Lehre hatte er als Steward bei der alten Hamburger Reederei Llaeisz auf einem der neuen Bananenschiffe gearbeitet, auf denen auch Passagiere mitfuhren. Hier bei uns an Bord fuhr er gleich als Leichtmatrose. Da ihm die Marinezeit angerechnet wurde, übersprang er somit die Moses- und Jungmannzeit. Es gab damals viele solcher Sonderregelungen für ehemalige Marineleute und -offiziere. Die normale Laufbahn eines Seemannes begann als Schiffsjunge, der dann über den Jungmann und Leichtmatrosen zum Matrosen befördert wurde. Danach konnte man sein Steuermannspatent machen und anschließend nach zwei Jahren Steuermannszeit das Kapitänspatent. Kapitän und Steuermann meines ersten Schiffes waren richtige Kümoschipper, und in meiner langjährigen Seefahrtszeit habe ich selten Leuteschinder solchen Formats und animalischer Primitivität erlebt. Der Kapitän war von kleinem, aber athletischem Wuchs. Er war dunkelhaarig mit asketischen zigeunerhaften Gesichtszügen. Im Kontrast zu seinem dunklen Gesicht waren seine Augen von hellgelber Farbe. Ich habe solche Augen bei keinem anderen Menschen vorher oder später gesehen. Sie erinnerten mich an unsere Hauskatze, die solche gelben Augen hatte. Unser Kapitän mochte etwa 42 Jahre alt gewesen sein und wurde von der Crew meistens „Giftzwerg“ genannt. Sonst heißt es an Bord allgemein „der Alte“, wenn vom Kapitän die Rede ist. Wurde er einmal wütend, lächelte er immer zuerst freundlich und wurde dann handgreiflich und gemeingefährlich.
Unser Steuermann war 32 Jahre alt. Im Gegensatz zum Alten war er ein großer sehniger Mann mit hellblondem Haar und schmalen Gesichtszügen. Er hatte hellblaue Augen und einen sehr jähzornigen Charakter. Wurde er wütend, was oft vorkam, warf er mit allem um sich, was ihm in die Hand kam. Er kriegte regelrechte Tobsuchtsanfälle. Dazu fluchte er fürchterlich, und das Objekt seines Zorns musste sich schnell in Sicherheit bringen. Ansonsten war er schweigsam, meist mürrisch und der geborene Antreiber und Leuteschinder. Seine Denkweise war primitiv und unkompliziert. Es ging das Gerücht, er habe sein Steuermannspatent nur nach mehrmaliger Wiederholung geschafft. Er war mit einer Sekretärin verheiratet, die ihm bildungsmäßig hoch überlegen war. Die Bindung muss vorrangig sexuelle Gründe gehabt haben, denn das einzige Thema, über das man mit ihm reden konnte, war das „Bumsen“. Sein Sexualtrieb muss stark ausgeprägt gewesen sein, denn wir haben es später selbst erlebt, dass, wenn seine Frau an Bord kam, eine stabile Person mit einem bemerkenswerten Hinterteil, keine zehn Minuten später die Matratze in seiner Kammer rhythmisch knarrte. Seine Kammer lag Wand an Wand mit unserer Kombüse, so dass wir diese Geräusche gut mitverfolgen konnten. Diese Vorgänge wiederholten sich dann sporadisch den ganzen Tag über. Wenn seine Frau das Schiff wieder verlassen hatte, war er anschließend einige Zeit lang ganz verträglich. Er war ein ausgezeichneter Seemann, und es gab keine seemännische Arbeit, die er nicht perfekt beherrschte.
Während sich unsere Mannschaftsunterkunft vorne unter der Back befand, wohnten der Alte und der Steuermann in hinteren Schiffsteil, wo sich auch Brücke, Maschinenraum, die Kombüse und das einzige Rettungsboot befand. Das Schiff hatte zwei Ladebäume, die mit Handwinden hochgedreht wurden, und zwei Motorwinden für den Lade- und Löschbetrieb. Vorne auf der Back befand sich das Motorankerspill und darunter der Kettenkasten für die beiden Anker, gleich neben unserem Mannschaftslogis. Unser Logis unter der Back bestand aus einem spitz zulaufenden Raum. Vier kastenförmige Kojen, je zwei übereinander, waren an das hintere Kollisionsschott angebaut. Eine zusätzliche Koje befand sich an der Backbordseite am vorderen Schott zum Kettenkasten. Links daneben war ein kleiner Waschraum von ca. 1,50 x 1,50 m abgeteilt. Am hinteren Schott backbordseits führte ein Aufgang zum Deck. Steuerbordseits stand ein fester kleiner Tisch mit einer Sitzbank direkt unter einem Bullauge. Gleich neben dem Tisch befanden sich ein Kanonenofen und ein Kohlenkasten. Zum Stauen der Ankerkette waren zwei Öffnungen neben der vorderen Koje in die Wand eingelassen. Wurde der Anker aufgehievt, musste einer von uns im Logis die Klappe zum Kettenkasten öffnen und dann während des Hievens mit einem Handhaken die Ankerkette stauen. So verhinderte man, dass sich beim nächsten Ankerwerfen die Kette vertörnte. Das Logis sah danach immer entsprechend aus! Wasser zum Waschen war rationiert und musste in einem Eimer von achtern nach vorne geschleppt werden. Die Toilette, eine kleine Kabine an Deck, befand sich vorne hinter der Back neben dem Niedergang zum Logis. Saß man bei bewegter See auf der Brille, peitschte das Seewasser durch das Abflussloch hoch und man musste seine Testikel in Sicherheit bringen.
Die Wohn- und hygienischen Verhältnisse waren schrecklich, aber wir waren jung, kannten es nicht anders und dachten, es müsse so sein. Da die Verhältnisse auf anderen Kümos ähnlich waren, nahmen wir alles als gegeben hin. Bei schwerem Wetter wurden wir vorne in unserem Massenlogis wie in einer Zentrifuge unhergeschleudert. Dazu kam das schlagende Geräusch der Ankerketten im Kettenkasten. Es hörte sich wie das Geläut von Kirchenglocken an. Im Winter musste bei schwerem Wetter auf See der Schornstein für unseren Kohleofen auf der Back abgebaut werden und es konnte deshalb nicht geheizt werden. Dann wurde es lausig kalt und nicht selten froren unsere Matratzen an der Eisenwand fest. War das Wetter zu schlecht, konnten wir unser Logis zur Wachablösung nicht verlassen, da es unmöglich war, über Deck nach achtern zu gelangen. Wir wären sonst über Bord gespült worden. Im Sommer herrschte in unserem Loch eine furchtbare Hitze und die Luft stand wie eine Glocke im Raum. Da konnte auch das kleine Bullauge keine Abhilfe schaffen. Wasser gab es pro Mann nur einen Eimer pro Tag zum Waschen. Zeugwäsche wurde grundsätzlich nur mit Seewasser und einer speziellen Seife für Salzwasser erledigt. Die Spülung erfolgte während der Fahrt mit Hilfe einer Wurfleine, an der die Wäsche im Kielwasser hinterhergeschleift wurde. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich mich während meiner 17monatigen Bordzeit auch nur ein einziges Mal mit warmem Wasser gewaschen hätte. Von einer Dusche träumten wir damals noch nicht mal. Der dumpfe, muffig-feuchte Geruch hing immer in unserem Logis so dass wir es schon gar nicht mehr merkten.
Als unbefahrener Moses stand ich in der Rangordnung an Bord natürlich ganz unten und musste, wie damals üblich, die niedrigsten Arbeiten verrichten. Da ich von nichts eine Ahnung hatte, nicht steuern konnte und so an Deck nicht zu gebrauchen war, steckte man mich zunächst für einen Monat in die Kombüse, auch wenn ich vom Kochen überhaupt nichts verstand.
Die Autoritätsperson unter der Back war also, wie bereits erwähnt, Günther. Er trug einen Schnauzbart, sprach gerne und sehr viel und verstand seinen Job. Uns Junggrade hatte er tüchtig unter Zug, wobei der Marinemaat immer wieder durchkam. Wir respektierten ihn. Er wollte noch bis zur Beförderung zum Matrosen an Bord bleiben und dann abmustern und hatte seine Zeit bald herum. Der nächste in der Rangordnung war Manfred, unser 19jähriger Jungmann, den wir alle „Hundepint“ nannten. Er war blond, groß und hatte schon auf zwei Kümos gefahren, auf der „Adelheid“ und „Käthe Hamm“. Den Spitznamen „Hundepint“ soll er bekommen haben, als er eines Morgens nackt aus seiner Koje sprang und ein Kollege beim Anblick seiner erigierten „Wasserlatte“ erstaunt ausrief: „Mensch, du hast ja einen Hundepint.“ Auf Plattdeutsch heißt dieser Begriff „Hundepenis“, und es gibt in der Seemannssprache einen solchen Begriff, der ein spitzzulaufendes Tauende so benennt. Dieses ist vorne eigens mit Segelgarn bewickelt und dadurch besser durch eine Öse oder Block zu stecken. da wir im Sommer fast alle nackt schliefen und nicht prüde waren, konnte ich mich selbst davon überzeugen, dass der Spitzname zutreffend war. Er hatte wirklich ein langes, nach vorne spitz zulaufendes Glied mit einem fingerhutförmigen Kopf. Sein Glied war fast immer erigiert, und die „Mädchen an der Küste“ schwärmten von seiner Potenz.
Manfred kam aus Hamburg und war in der Nähe der Reeperbahn groß geworden. Sein Vater war im Krieg gefallen, und seine Mutter arbeitete als Schaffnerin bei der Straßenbahn. Er war ein guter, aber empfindlicher Kamerad, und ich verstand mich mit ihm am besten von allen. Da ich auf meiner ersten Reise von nichts eine Ahnung hatte, half er mir an Bord bei meinen Schwierigkeiten, wo er nur konnte. Er war ein guter Seemann und sollte bald Leichtmatrose werden. Anschließend wollte er auf „Große Fahrt“ gehen. An den anderen befahrenen Moses kann ich mich nicht mehr so gut erinnern, da er auch nicht lange an Bord blieb. Ich weiß nur noch, dass er ein ruhiger 17jähriger Bursche war und einen ziemlich deprimierten Eindruck machte. Später, nachdem ich selbst längere Zeit an Bord war, konnte ich ihn verstehen. Auch ich war manchmal nahe dran, alles hinzuschmeißen und die Seefahrt an den Nagel zu hängen. Da wir schon einen Moses an Bord hatten, nannten mich alle merkwürdigerweise nur „Seemann“, und diesen Namen sollte ich die ganzen 17 Monate, die ich an Bord blieb, behalten. Der Ton zu uns Junggraden an Bord war rau und Worte wie „Dummes Schwein“, „ich trete dir in den Arsch“ oder „ich hau dir welche an den Hals“ waren an der Tagesordnung und manchmal setzte es wirklich was.
Da ich als unerfahrener Neuling an Deck nicht zu gebrauchen war, wurde ich also in die Kombüse gesteckt. Aber auch dort hatte ich von nichts eine Ahnung. Nach drei Tagen intensiver Einweisung durch den Steuermann mit Fußtritten, Flüchen und Drohungen wie beispielsweise „ich hau dich an die Wand, dass du Lumpen kotzt“ oder „dich hätte die Hebamme gleich nach der Geburt erwürgen sollen“ wusste ich in etwa, wo es lang geht. Kochen konnte ich zwar immer noch nicht, und der Steuermann musste einspringen, aber zumindestens konnte ich den Kohleherd anzünden und Kaffee und Tee aufgießen. Mein Tag begann in der Frühe um 5.30 Uhr, wenn die 6.00-12.00-Uhr-Wache geweckt wurde. Um 6 Uhr heizte ich den Kohleherd an, was bei Regenwetter und schwerer See nicht immer gleich gelang, und manchmal musste ich mit einer Konservendose voll Gasöl nachhelfen. Wehe, wenn mich der Alte oder der Steuermann dabei erwischte! Dann setzte es Maulschellen und Fußtritte. Nach dem Herdanheizen musste ich mit der Handpumpe den Kombüsentank mit Trinkwasser (seemännisch ausgedrückt: mit Frischwasser) auffüllen und Kaffee auf die Brücke zum Alten bringen. Die Kaffeebohnen hatte der Steuermann, der die Wache an den Alten übergab, vorher abgezählt. Bei dieser Gelegenheit bekam der Bordhund seine halbe Dose Kondensmilch in seinem Napf zum Frühstück serviert. Wir vier vorne unter der Back mussten mit einer Dose die ganze Woche auskommen. Nachdem der Steuermann mit meiner Assistenz das Mittagessen vorbereitet hatte, brachte ich um 7.30 Uhr eine große Kanne „Muckefuck“ (Ersatzkaffee) nach vorne. Unser Frühstück war spartanisch: außer genügend schwarzem „Kommissbrot“, Margarine und Heizer-Jam (Marmelade in Dosen) gab es nichts.
Wir lebten noch unterhalb des vorgeschriebenen Proviantsatzes. Gemäß Speiserolle hatte jeder einmal in der Woche 50 g Bohnenkaffee zu beanspruchen, den wir dann alle am Sonntag zusammenwarfen und uns eine anständige Tasse Kaffee gönnten. Auch standen uns pro Woche zwei Eier zu, die wir dann zu unserem Kaffee zum Frühstück verspeisten. Die Speiserolle billigte uns auch jede Woche einen Zipfel Dauerwurst, eine Scheibe Käse, etwas Zucker und ein Scheibchen Butter zu, aber unser Alter fuhr eben unter dem Satz der Speiserolle. Nicht gespart wurde an Zucker und schwarzem Tee. Nach dem Frühstück törnten (arbeiteten) die anderen an Deck zu, während ich das Mittagessen kochen musste. Da es damals auf den Kümos weder Kühlschränke, geschweige denn Kühlräume gab, wurde, wenn die Reise länger dauerte, wie in historischen Seefahrtszeiten viel Rauch- oder Salzfleisch verwendet. Nur während der Hafenliegezeiten und zwei Tage danach konnte man frisches Fleisch kaufen und verzehren. Am Essen wurde radikal gespart, und wir hatten an Bord eigentlich immer Hunger. Es wurde auch ständig über das Essen gemeckert, meistens berechtigt, aber gelegentlich auch unberechtigt. Beschwerden beim Alten hatten fast immer Entlassung zur Folge, denn das Thema Proviant und Essen an Bord war innerhalb der deutschen Seefahrt eine Heilige Kuh, die man nicht anzutasten hatte. Man konnte sich über die Arbeit, die Behandlung oder die Vorgesetzten beschweren, nicht aber über das Essen. So wurde meist intern unter der Back über den Fraß oder die zu kleinen Portionen geschimpft und da ich ja gewissermaßen für das Essen zuständig war, musste ich dafür herhalten. Ob ich Schuld hatte oder nicht, spielte keine Rolle. Die Speisepalette reichte von der Linsensuppe über Labskaus, „Frische Suppe“ bis zum seltenen Braten im Hafen. Satt wurden wir nie.
Nur einmal im Monat konnten wir uns den Bauch voll schlagen: Da gab es „Plum un Klüten“, ein altes norddeutsches Gericht: Backobst wurde mit einer Speckseite zusammen gekocht, dazu gab es mit Wasser hergestellte Mehlklöße. Jeder von uns bekam ein gut bemessenes Stück Speck und wir aßen, bis wir nicht mehr konnten. Ein beliebtes Schlagwort des Alten war: „Ihr seid hier nicht an Bord, um satt zu werden, sondern nur zum Überleben.“ Wenn unser „Giftzwerg“ einen getrunken hatte, änderte er sein Motto in: „Wir wollen euch hier nicht mästen, sondern nur am Leben erhalten.“ Abends gab es immer nur Bratkartoffeln mit Zwiebeln, Tag für Tag, Monat für Monat. Uns hingen die Bratkartoffeln zum Halse raus, aber man hatte wenigstens etwas im Magen. Ich weiß nicht, ob es auf anderen Kümos besser war, bei uns jedenfalls war Schmalhans Küchenchef. Versaute ich einmal ein Mittagessen, gab es „was an die Wäsche“ oder ich musste die ganze Woche den Fraß aufgewärmt alleine essen. Einmal hatte ich aus Gedankenlosigkeit die Bohnen zweimal gesalzen, was ich erst beim Abschmecken merkte. In meiner Angst und Verzweiflung wollte ich das durch eine gleiche Menge Zucker wieder ausgleichen. Der Fraß schmeckte wie „Knüppel auf den Kopf“, aber irgendwie gelang es mir, die anderen und sogar den Steuermann zu überzeugen, dass es an den Bohnen gelegen habe. Gott sei Dank waren es unsere letzten Bohnen gewesen.
Ein großes Problem war für mich auch der verflixte Kohleherd, der bei Regenwetter überhaupt nicht zog und ich dann in Folge das Essen nicht rechtzeitig fertig bekam. Dann erschien der Alte und fluchte fürchterlich. Sein Lieblingswort war dabei „Wichskopf“: „Du verfluchter Wichskopf bist sogar zu dumm zum Feuermachen, dich sollte man über Bord werfen.“ Von den Kommentaren und Flüchen der übrigen unter der Back ganz zu schweigen. Hatte ich einmal vergessen, den Kombüsen- oder Scheißhaustank achtern mit der Hand aufzupumpen, drehte er durch und ich musste sehen, dass ich wegkam. Bekam er mich zu fassen, gab es Prügel und an eine Gegenwehr war nicht zu denken. Während der Alte und der Steuermann in einer kleinen Nische neben der Kombüse aßen, musste ich das Essen für uns in besonderen „Backen“, drei Behälter übereinander in einem Traggestell, nach vorne unter die Back schaffen. Bei schlechtem Wetter oder Deckslast war das ein abenteuerliches Unternehmen und nicht immer kam ich heil an. Dann gab es vorne kein Essen und die Stimmung war explosiv. Bei zu schwerem Wetter wurde nicht gekocht und es gab nur „kalt“. Die Mahlzeit bestand dann meistens aus einer kleinen Dose Corned Beef und ein paar Ölsardinen.
Kamen wir einmal nach Schweden, verkauften wir alle „schwarz“ unsere eine Flasche „Eau de Vin“, die uns der Alte pro Monat aus dem Kantinenschrank zusammen mit den Zigaretten aushändigte. Wir bezahlten für die Flasche zollfrei 1,36 DM und verkauften sie in Schweden für ca. 20 Kronen, was in etwa 18 Mark entsprach. Da in Schweden der Alkoholverkauf bzw. -konsum staatlich kontrolliert war, was einem Verbot gleichkam, war der Zoll besonders scharf, und die „Schwarze Gang“ filzte jedes Schiff. Die Strafen waren horrend. Es braucht wohl nicht erwähnt zu werden, dass der Alte und der Steuermann den Schnaps kistenweise, im Maschinenraum versteckt, schmuggelten. Sie wurden nie erwischt. Das fuchste uns schon, da wir mit nur einer Flasche abgespeist wurden. Am liebsten hätten wir sie beim Zoll hochgehen lassen, aber das wagte dann doch niemand. Wenn wir unsere Flasche verkauft hatten, stürzten wir mit dem Geld in die nächste Konditorei, wo wir uns dafür Kuchen kauften, den wir gleich an Ort und Stelle verputzten. Das muss furchtbar ausgesehen haben, denn einmal fragte uns die Verkäuferin, ob wir Deutsche seien und es bei uns an Bord keinen Kuchen gäbe. Wir schilderten unsere Situation in den düstersten Farben, und der armen Frau muss eine Gänsehaut heruntergelaufen sein. Jedenfalls durften wir während der Liegezeit in diesem Hafen nach Geschäftsschluss den Bruch oder die nicht verkauften Reste abholen. Wir veranstalteten dann vorne richtige „Kuchenfressorgien“. Einmal kam der Steuermann, der misstrauisch geworden war, und dann ging mit ihm der primitive Neidinstinkt durch. Er bekam einen roten Kopf und schrie: „Nur jeden Tag Kuchen fressen und nichts in der „Mau“ haben.“ Anschließend verschwand er wutentbrannt aus unserem Logis.
In der Kombüse lernte ich auch das in der Rangordnung noch über mir stehende „Besatzungsmitglied“ kennen, mit dem mich ein 17monatiges Hass- und Freundschaftsverhältnis verbinden sollte: die bereits erwähnte vierjährige Bordhündin des Eigners, die sich schon zwei Jahre an Bord befand und außergewöhnliche Privilegien besaß. Der Rasse nach war sie eine mittelgroße schwarze Pudelhündin aus Dänemark mit Stammbaum. Gleich auf meiner ersten Reise verscherzte ich mir meine Sympathien bei unserer Hundelady „Daisy“. Da ich ja kein Bettzeug besaß, musste ich auf der nackten Seegrasmatratze in meinen Arbeitsklamotten schlafen. Da jeder sein eigenes Bettzeug hatte, war nirgends eine Decke aufzutreiben. In einem Anfall von unbegreiflicher Menschlichkeit, die ihm gewiss enorme Überwindung gekostet haben muss, gab mir der Alte Daisys Decke. Jeden Morgen, wenn ich in die Kombüse kam, roch sie ja an mir ihre geliebte Decke und reagierte äußerst aggressiv mit gefletschten Zähnen. Um das Maß voll zu machen, stahl ich auch einen Teil von ihrer Milch. Ich wusch also am Abend vorher ihren Napf besonders gründlich sauber und wartete dann am anderen Morgen, bis der Steuermann die Milch eingeschüttet hatte. Wenn er gegangen war, schüttete ich die Hälfte davon in eine kleine Dose und verdünnte Daisys Milch mit Wasser. Die geraubte Milch brachte ich dann nach vorne für unsern Kaffee. Daisy war nicht dumm, merkte das und vergaß es mir nie. Wir wurden nie gute Freunde. Aber irgendwie waren wir auch aufeinander angewiesen und das verband uns. Ich weiß nicht, wie oft sie mich hasserfüllt angebellt hat, aber ich war der einzige an Bord, der sie manchmal an Land ausführte und das wusste sie. Meistens war sie beim Alten oder Steuermann auf der Brücke, und nur bei schwerem Wetter verkroch sie sich bei mir in der Kombüse. Die Kümos rollen bei schwerer See fürchterlich, und es war mir dann oft nicht möglich, nach vorne zu kommen, ohne über Bord gespült zu werden. Dann saßen wir beide in Notgemeinschaft zusammengedrängt in der Kombüse wie zwei Häufchen Elend und warteten auf Wetterbesserung. War alles vorbei, bestand wieder der alte gespannte Zustand zwischen uns.
Nach dem Geschirrabwaschen und „Aufklaren“ in der Küche und vorne und dem Reinigen der Kammern des Alten und des Steuermanns begab ich mich auf See auf die Brücke um steuern zu lernen. Der Steuermann schickte dann den Rudergänger zum Arbeiten an Deck, während ich bis 17 Uhr am Ruder stand. Das erste Mal am Steuerrad stehen zu dürfen, war für mich ein erhabener und ehrfurchtsvoller Augenblick. Das große hölzerne Steuerrad war mit Kettenzügen mit dem Ruderblatt verbunden und man musste schon kräftig drehen, damit das Schiff gehorchte. Bis ich soweit war, dass ich nach dem Kompass steuern konnte, musste ich viele Fußtritte und Flüche einstecken. Manchmal, wenn ich bei gefährlicher Annäherung eines anderen Schiffes aus dem Ruder scherte, sprang der Alte oder der Steuermann ans Ruder, wobei ich weggeschleudert wurde, bis die Situation wieder klar war. Anschließend hagelte es Flüche und Drohungen bis zum „Sack“. Den „Sack geben“ bedeutete die Entlassung und war die häufigste und gefährlichste Drohung. Denn war man entlassen und hatte dadurch eine schlechte Fahrzeit im Seefahrtbuch, musste man mit diesem Makel eventuell monatelang auf ein neues Schiff warten.
Entlassen konnte der Kapitän nach Belieben. Ein Grund fand sich immer. Nur die 48 Stunden Kündigungsfrist musste er einhalten. So war die Drohung: „Im nächsten Hafen bekommst du den Sack!“ die schlimmste und zog immer. Um 17 Uhr, nach dem Steuern, musste ich schon wieder das Abendessen, eben die erwähnten Bratkartoffeln, bereiten. Nach dem Abendessen und der „Backschaft“ ließ mich der Alte noch bis 20 Uhr steuern. Zwischendurch hatte man mir auch schon beigebracht, wie man die Maschine auf See während der Fahrt „abschmiert“ und mit der Handpumpe den Brennstofftank aufpumpt. So lösten mich der Alte oder der Steuermann alle zwei Stunden am Ruder ab und schickten mich zum Abschmieren in den Maschinenraum. Um etwa 21 Uhr durfte ich dann nach vorne zum Schlafen gehen, wo ich mich nach einem Fünfzehnstundentag todmüde in die Koje fallen ließ. Nach den Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes hätte man mir einige Pausen zubilligen müssen. Aber daran hielt sich niemand in der Küstenschifffahrt.
Im Hafen musste ich mit an Deck arbeiten. Es gab einen Begriff an Bord, welchen die Kümoschipper und Reeder erfunden hatten: „Schiffsinteresse“. Das Schiffsinteresse erfordere von der Besatzung, auch mal ohne Bezahlung zu arbeiten. In diesem Sinne wurde auch das Wort „Schiffssicherheit“ oft verwendet, denn Arbeiten, die der Sicherheit des Schiffes dienten, durften nicht verweigert werden. Auch wenn es sich nur um Instandsetzungsarbeiten handelte, wurden sie oft als der Schiffssicherheit dienend deklariert. Man konnte ein Schiff außenbords malen lassen und sagen, dies diene der Schiffssicherheit, da ja der Rostfraß das Schiff angreife. Es gab dafür natürlich genau definierte gesetzliche Regelungen, aber wir waren in diesen Dingen unerfahren und kannten es nicht anders. Zeigte jemand zu wenig „Schiffsinteresse“ und wollte während der Hafenliegezeit im Sommer nach 18 Uhr nicht ohne Bezahlung arbeiten, wurde er bei günstiger Gelegenheit wegen Interesselosigkeit und mangelnder Zuverlässigkeit entlassen. Auch mussten wir damals froh sein, überhaupt eine Anstellung an Bord zu haben.
Unsere Reise ging also nach Finnland, wo wir in einem kleinen Hafen, er hieß wohl Haukipudas, auf Reede Schnittholz luden. Das Holz wurde mit Lastkähnen an das Schiff gebracht und dann mit unseren zwei Ladebäumen in den Laderaum gehievt. Dort wurde es Brett für Brett von Frauen in Lagen gestaut und festgekeilt. Es war das erste Mal, dass ich Frauen als Hafenarbeiterinnen sah. An den Motorwinden für die Schwingladebäume lösten sich der Steuermann, der Leichtmatrose Günther und unser Jungmann „Hundepint“ ab. Wir Schiffsjungen durften noch keine Winde bedienen. Im Grunde waren auch der Leichtmatrose und Jungmann als „Junggrade“ nicht dazu berechtigt, und der Alte hätte zwei erfahrene Windenleute von Land anheuern müssen. Aber solange kein Unfall geschah und keine Kontrolle stattfand, nahm er es eben auf seine Kappe. Es durfte eben nichts passieren! Wir waren natürlich alle scharf auf die Frauen, da auch einige sehr junge dabei waren, aber ich kann mich nicht entsinnen, dass sich eine von ihnen verführen ließ. Wahrscheinlich unterstanden sie einer strengen Disziplin und hätten sofort ihren Arbeitsplatz verloren. Da keine von ihnen deutsch und wir nicht finnisch sprachen, konnten wir uns mit ihnen nur in Zeichensprache verständigen, was viel Gekicher und Gelächter auslöste. Wenn unser Steuermann das mitbekam, brach wieder sein primitiver Neidinstinkt durch, und er trieb uns zur Arbeit an.
War der Unterraum vollgestaut, musste die Luke seefest verschlossen werden, was harte Knochenarbeit bedeutete. Auf die geschlossene Luke kam eine Deckslast Holz. Da die Arbeiter während dieser Unterbrechung nicht weiter stauen konnten und Zeit Geld bedeutete, musste jeder von uns heran, selbst der Alte. Zuerst mussten mit den Ladebäumen und den Winden die schweren „Scheerstöcke“, große eiserne Querträger, von oben in die Luke eingesetzt werden. Dadurch wurde die Luke in einzelne Partien geteilt, in die dann Holzlukendeckel, ca. 150 Stück, per Hand eingesetzt wurden. Jeder Holzlukendeckel war zwei Meter lang und an den Enden mit Eisen beschlagen, so dass nur zwei Mann sie heben konnten. Sie wurden von zwei Leuten vom Deck auf das Lukensüll gestemmt und dort von zwei anderen in den einzelnen Partien ausgelegt. Anschließend wurde die so geschlossene Luke durch drei schwere übereinandergelegte Persennige abgedeckt und durch Holzkeile an den Lukelsüllseiten festgekeilt. Danach wurde das Ganze durch zwölf schwere Eisenbügel, die querschiffs lagen, mit Schraubverschlüssen befestigt. Darüber kam dann die Holzdeckslast, die nach Beendigung des Ladens durch schwere Ketten gesichert wurde, die quer zum Schiff über die Ladung gespannt werden mussten.
Solche Decksladungen mit Schnittholz waren für kleine Kümos bei schlechtem Wetter äußerst gefährlich, besonders im Winter, wenn Vereisungsgefahr bestand. Schlägt die See nämlich eine Zeitlang über die Deckslast, saugt sich das Holz voll Wasser und wird an der Luvseite schwerer. Durch Vereisung erhöht sich das Gewicht, so dass das Schiff Schlagseite bekommen und kentern kann. So passierte es manchmal, dass man morgens auf See bei 20 Grad oder mehr Schlagseite aufwachte. Dann war „Holland in Not“, und es bestand höchste Lebensgefahr. Schlugen nun weitere Brecher auf die Schlagseite, konnte das Gewicht noch vergrößert und somit das Schiff zum Kentern gebracht werden. Der Alte drehte das Schiff dann in einer solchen Situation mit dem Bug in den Wind, und wir mussten angeseilt bei dem schweren Wetter und der Schräglage die Decksladung in die See werfen: Eine mörderische und gefährliche Arbeit! Man musste die Ketten, die in der Mitte mit einer Spannschraube und einer Slipvorrichtung die Ladung zusammenhielt, „slipen“ (gleiten / lösen), so dass die Ladung durch die Schräglage in die See stürzte und das Schiff sich aufrichten konnte. Da es mehrere Ketten waren, wurde soviel Ladung „geslipt“, bis die Gefahr vorüber war. Bei diesem sogenannten „Seewurf“ bestand meist die Gefahr, dass man selbst mit der Ladung in die See gerissen wurde, besonders bei Vereisung und nachts. Eine andere unangenehme Gefahr bei Holzdecksladungen, die ich auch selbst erlebt habe, konnte dadurch entstehen, dass bei schwerer vorderlicher See die Decksladung nach vorne rutschte und den Eingang zu unserem Logis unter der Back blockierte. Man war dann vorne wie eine Ratte in der Falle gefangen, denn der Eingang war damit durch Tonnen von Holz versperrt, ein furchtbares Gefühl. Wir saßen nun stunden- oder tageweise vorne eingesperrt, bis uns bei Wetterbesserung die drei Mann von achtern mit Äxten, Brechstangen und Sägen befreiten. Selbst bei ruhigem Wetter und leichtem Seegang konnte die Deckslast gefährlich werden. Bei Vereisung konnte man trotz der vorgeschriebenen Stützen und Strecktaue ins Rutschen kommen und dabei außenbords gehen. Für mich als Kombüsen-Moses war es beim Transport der schweren „Backen“ bei Seegang und Glatteis besonders gefährlich, das Essen nach vorne zu bringen, denn ich hatte nur eine Hand zum Festhalten frei. Auch für die Wachablöser, die bei stockfinsterer Nacht über die Deckslast turnen mussten, war es immer wieder ein gefährliches Unternehmen, und mancher Seemann verschwand dabei für immer.
Unsere Holzladung aus Finnland ging nach Lübeck, wo wir an einem Freitagmorgen an der Holzkai von „Krages“ festmachten. Aus irgend einem Grunde sollte erst am Montag gelöscht werden. Der Alte und der Steuermann fuhren übers Wochenende zu ihren Familien nach Hamburg. Der Alte nahm Daisy mit und drohte uns mit fürchterlichen Strafen, falls in seiner Abwesenheit etwas passieren sollte. Da ich der jüngste Dienstgrad an Bord war und sowieso kein Geld hatte, wurde ich zur Hafenwache verdonnert. Der andere Moses wohnte in Lübeck und durfte nach Hause fahren. Günther und „Hundepint“ wollten, bevor sie am Samstag Vormittag nach Hause fuhren, noch abends „an die Küste“ und in der „Kajüte“, einer beliebten und berüchtigten Seemannskaschemme, zwei Damen abschleppen. In der „Kajüte“ traf sich die ganze Küstenschifffahrt. Die dort tätigen Mädchen waren wandelnde Schifffahrtsregister, die über jedes Kümo und dessen Besatzung das Neueste wussten. Gleichzeitig waren sie trinkfest und hatten ein sehr weites Herz. Natürlich ließen sie sich für ihre Dienste bezahlen, aber wenn man ihr Typ war, spielte Geld nicht mehr immer eine Rolle.
Es war das erste Mal, dass ich mit meinen 16 Jahren, wenn auch nicht als Beteiligter, mit der Sexualität an Bord konfrontiert wurde. Natürlich war unser Hauptgesprächsstoff unter Kollegen immer das „Thema Nr. 1“, die Frauen und unser „Hundepint“ und auch Günther, der Leichtmatrose, waren wahre Experten, was Nutten und „leichte Damen“ betraf. Besonders „Hundepint“ war trotz seiner relativen Jugend an der Küste bei den Damen als großer „Bumser“ und feuriger Liebhaber berühmt. Gerade seine abnormale Männlichkeit war bei den Mädchen an der Küste als Attraktion bekannt und sehr gefragt. Außerdem war er groß, blond und blauäugig und sah gut aus. Wenn er einmal an der Back seine amorösen Abenteuer in allen Details schilderte, konnten wir beiden Mosese nur vor Neid erblassen. Gegen 2 Uhr morgens wurde ich durch lautes Singen und Frauengelächter aufgeweckt. „Hein Seemann“ kam von Land zurück! Die lustige Gesellschaft begab sich ins Logis, und Günther schob mir eine Flasche abgestandenen Sekt durch den Vorhang meiner Koje und rief: „Trink mal einen Schluck, „Seemann“, und begrüß unsere Damen. Die Damen waren eine 22jährige Brünette mit ansehnlicher Figur und schwesterlichen Gesichtszügen, die an der „Küste“ unter dem Namen „Erbse“ bekannt war, und eine ca. 24jährige gut proportionierte Blondine mit blauen Augen und überreifem Babygesicht, „Uschi“ genannt, beide erfahrene Dockschwalben. Hundepints „Erbse“ rief plötzlich: „Ist das der „Seemann“? Den muss ich sehen!“ und leuchtete mir mit unserer Petroleumlampe ins Gesicht. „Der ist aber wirklich süß,“ rief sie begeistert aus und fuhr mir mit der Hand routiniert zwischen die Beine. „Und einen süßen Schwanz hat er auch,“ bemerkte sie anerkennend. Anschließend kam man zur Sache und während „Hundepint“ mit „Erbse“ in der oberen Koje verschwand, zog sich Günther mit seiner Uschi in die untere zurück. „Hein Seemann“ kam auf seine Kosten, und die Damen unterhielten sich dabei ungeniert. Am späten Morgen stand eine ziemlich verkaterte Gesellschaft auf, und „Hein Seemann“ machte einen sehr erschöpften Eindruck. Ich brachte schnell eine große Kanne Bohnenkaffee, unsere Sonntagsration, nach vorne und nach ein paar Spiegeleiern, auch Sonntagsration, waren die Stimmung und die alte Kraft wieder hergestellt. „Erbse“ fand mich immer noch süß und versprach, mich am Abend zu besuchen. „Hundepint“ und Günther brachten ihre Damen, nachdem sie abgerechnet hatten, von Bord und fuhren anschließend nach Hause. „Erbse“ kam nicht und ich behielt meine „Unschuld“.
Nach zwei Monaten Küchendienst durfte ich an Deck arbeiten, was ich im Hafen sowieso schon teilweise getan hatte. Ich löste mich mit dem anderen Moses dann jede Woche ab, so dass jeder umschichtig eine Woche Kombüsen- und eine Woche Decksdienst hatte. Unser Kümo bekam ständig Ladung und so waren wir fast ununterbrochen unterwegs. Wir schipperten zwischen England, Holland, Belgien, Schweden, Dänemark, Polen, DDR, Irland, Westdeutschland und Finnland umher und kamen nicht zur Ruhe. Wir kannten fast alle großen Häfen, und manchmal liefen wir Plätze an, die auf keiner Karte verzeichnet waren. Auch luden wir alles, was transportiert werden konnte, von Kohle und Koks über Papier, Stückgut, Schrott, Holz, Kali, Getreide bis zu Granitsteinen aus Gotland, um nur einiges zu nennen. Hatten wir gerade eine Kohleladung aus Cardiff gelöscht und sollten Getreide laden, so wurde der Laderaum in Tag- und Nachtarbeit gewaschen, um nur ja pünktlich zum Ladebeginn bereit zu sein und den Transportauftrag nicht zu verlieren. Meistens erreichten wir den Ladehafen im letzten Moment. und unser Schiff wurde aus dem Stand sofort beladen.
Gefürchtet waren von uns Kohle- und Koksladungen, da wir sie im Hafen selbst im Laderaum trimmen mussten. War der Laderaum bis zum unteren Lukenschacht - ca. ein Meter bis zum Deck - mit Kohle oder Koks beladen, mussten wir auf dem Bauch in die letzten Ecken unter Deck kriechen und sie voll schaufeln. Man lag dann etwa 4 bis 5 Meter vom Lukenschacht entfernt auf dem Bauch unter Deck, ausgerüstet mit Schaufel, Trimmblech und Kabellampe. Nun wurde man von oben durch den Greifer des Krans mit Kohle zugeschüttet und musste unter Deck mit sehr wenig Luft zum Atmen bäuchlings den Freiraum, in dem man lag, zuschütten, indem man über das Trimmbrett hinweg tonnenweise Kohlen in die Freiräume schaufelte. Hatte man einen Berg weggeschaufelt, kam bereits der nächste Greifer voll. Aus lauter Angst vor dem Ersticken schaufelte man dann wieder, um Luft zu bekommen. Für Leute mit Platzangst war das eine furchtbare Tortur, und einige sollen dabei weiße Haare bekommen haben.
Für Jugendliche war das Trimmen strengstens verboten, aber wer kümmerte sich schon darum? Für das Trimmen gab es außer der Überstundenheuer extra Geld, aber nach heutigen Maßstäben war das minimal. Nach dem Trimmen waren wir so fertig, dass uns der Alte einen Schnaps einschenken musste. Auch ich bekam einen. Am liebsten fuhren wir nach Finnland zum Holzladen, da dort nur am Tage gearbeitet wurde und wir mindestens eine Woche Hafenliegezeit hatten. Da auch dort, wie in Schweden, Alkohol rationiert war, konnten wir unsere Flasche „Eau de Vin“ für umgerechnet 20 DM an den Mann bringen und hatten etwas Taschengeld, von dem wir uns Limonade und Eiskreme kaufen und mit den Mädchen schäkern konnten. Die finnischen Mädchen hatten ein sehr weites Herz und „Hein Seemann“ war zufrieden.
Auf diesen Reisen fuhr auch manchmal der Eigner als Kapitän mit, und so lernte ich zum erstenmal diesen eigenartigen Menschen kennen. Er war Mitte fünfzig, grauhaarig, groß und hatte einen ausgeprägten „Spitzkühler“. Günther sagte immer: „Wenn der seinen Schwanz sehen will, braucht er einen Spiegel.“ Unser Eigner besaß das „Große Kapitänspatent A6“ und soll vor dem Krieg als 1.Offizier auf einem großen Passagierdampfer gefahren haben. An seiner linken Hand trug er immer einen großen Diamantring, und unser „Giftzwerg“ und der Steuermann begegneten ihm mit großem Respekt. Er sprach immer sehr kultiviert, auch wenn er wütend war. Nur seine Augen wurden dann starr, wie bei einem Fisch und seine gewählte Stimme wurde etwas lauter. Manchmal kanzelte er unseren Alten und den Steuermann ab, und sie schlichen dann wie geprügelte Hunde übers Deck. Unser Arbeitgeber wohnte in einer besseren Gegend von Hamburg, wo er ein eigenes Haus besaß. Er hatte einen Sohn, der bei einer großen Reederei als Zweiter Offizier fuhr und eine 19jährige Tochter, die studierte. Seine Frau fuhr des öfteren mit und machte, so wie ich sie später kennen lernte, einen sehr arroganten und unbefriedigten Eindruck.
Fuhr unser Eigner mit, war sein Lieblingsplatz die Kombüse, und für uns alle an Bord brachen noch schlechtere Zeiten an. Er schnippelte an unseren schon mageren Rationen wie ein Chirurg herum und verwertete alles. Gott sei Dank, dass wir keine Apothekerwaage an Bord hatten. Reichten die Erbsen, Linsen oder Bohnen nicht mehr für eine Mahlzeit aus, wurde alles in einen Topf geworfen und mit übriggebliebenen Fleisch- und Wurstresten zu Mittag serviert. Seine Sparsamkeit nahm so groteske Züge an, dass sie auch den Alten und den Steuermann nicht verschonte. So musste ich nachmittags in der Kombüse den Kaffeesatz vom Morgenkaffee noch einmal aufbrühen. Unser Alte wurde daraufhin so fuchsteufelswild, dass er die Kaffeekanne in die Ecke schleuderte. Daraufhin gab es für ihn und den Steuermann wieder guten Bohnenkaffee. In Finnland, wenn am Sonntag nicht gearbeitet wurde, mussten wir im Sommer unser Rettungsboot aussetzen und alle zusammen auf eine der kleinen verlassenen Inseln rudern und Bickbeeren (Blaubeeren) sammeln. Wenn wir dann, von Mücken zerstochen, mit unseren vollen Eimern und Kreuzschmerzen gegen Abend wieder an Bord waren, gab es keinen von uns, der nicht den Tag herbeisehnte, an dem unser Eigner uns wieder verließ.
Als wir wieder einmal die Schleuse Holtenau in Kiel in Richtung Ostsee verließen und ich an Deck arbeitete, passierte mir ein nicht alltägliches Missgeschick. Es hätte für mich tragisch enden können. Nachdem wir bei sonnigem Wetter gegen Mittag bei Windstärke 3 bis 4 die Kieler Förde verlassen hatten, löste mich der Alte am Ruder ab. Er befahl mir, während die ablösende Wache aß, das Deck mit der „Schlagpütz“, vorkante (Vorderseite) Brücke abzuspülen. Eine „Schlagpütz“ ist normalerweise ein kleiner, eigens dafür hergestellter Eimer mit einer langen Leine dran. Man wirft den Eimer mit einer gekonnten Bewegung über Bord ins Wasser und zieht ihn dann mit Wasser gefüllt an der Leine wieder hoch und wäscht damit das Deck. Dies wiederholt man so lange, bis das Deck sauber ist. Aus irgend einem Grund war die „Schlagpütz“ nicht aufzufinden und ich befestigte in meiner Unerfahrenheit unsere dünne Schmeißleine an einem normal großen Eimer. Als ich mich an Deck, vorkante Brücke, zwischen zwei Pollern (zum Belegen der schweren Schiffsleinen) auf die Reling stellte und die provisorische Schlagpütz mit einem eleganten Schwung ins Wasser warf, wurde ich durch den Fahrtstrom über Bord gerissen. Da dies vorkante der Brücke passierte und alle anderen unter Deck beim Essen waren, wurde der Unfall von niemandem bemerkt. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt mein bestes knallgelb-rotes Landgangshemd an, da die zwei Arbeitshemden zur Wäsche eingeweicht waren. Dieser Tatbestand rette mir wahrscheinlich das Leben. Während ich in der unruhigen See um mein Leben schwamm und das Heck meines Schiffes am Horizont immer kleiner wurde, bemerkte ein großer Zollkreuzer des Wasserzolls mein knalligfarbenes Hemd in der See und drehte sofort auf mich zu. Mir wurde ein Rettungsring zugeworfen, an dem ich mich mit letzter Kraft festhielt. Anschließend wurde ich an Bord gezogen. Da mein Schiff noch eben in der Ferne zu sehen war, brauste der Zollkreuzer mit mir mit äußerster Maschinenkraft hinterher, wobei wir gut eine halbe Stunde brauchten, bis wir längsseits waren.
Nach einigen Signalen mit dem Typhon bemerkte unser Alter, dass irgend etwas im Gange war und stoppte die Maschine. Ich werde nie sein entgeistertes Gesicht vergessen, als er mich mit offenem Mund anstarrte. Auch der Steuermann und die anderen an Bord, die durch den Lärm an Deck gelockt worden waren, starrten mich wie einen Geist an. Aber der Alte wäre nicht der Alte gewesen, hätte er nicht reagiert, wie er reagiert hat. Nachdem sich seine erste Verblüffung gelegt hatte, lächelte er zuerst und dann legte er los und schrie: „Wo kommst du denn her, du Wichskopf, du dummes Schwein. Zu dumm, eine Pütz aufzuschlagen. Dich hätte die Hebamme gleich bei der Geburt erwürgen sollen, du Wichskopf.“ Dieser Wutanfall verschlug selbst den Zollbeamten die Sprache, und der Kapitän des Zollkreuzers fuhr unseren Alten an: „Nun seien Sie aber mal ruhig, Kapitän, seien Sie froh, dass wir den Jungen überhaupt gefunden haben und nun schicken Sie ihn mal unter Deck, damit er sich trockene Klamotten anziehen kann.“ Der Alte war nicht zu bremsen und schrie mich an: „Verschwinde, du Wichskopf und ab in die Kombüse. Die Pütz zieh ich dir von der Heuer ab, die bezahlst du mir.“ Ich brauchte die Pütz nicht zu bezahlen, verbrachte aber wieder einige Zeit in der Kombüse.
Manchmal, wenn wir aus der Ostsee durch den Kiel-Kanal in die Elbe kamen, um in die Nordsee zu gehen, mussten wir in Cuxhaven „vor Wind gehen“. Dies geschah immer dann, wenn der Seewetterbericht für die Nordsee Sturmwarnung gegeben oder gar Orkan gemeldet hatte und deshalb mit Sturmschäden oder Gefahr des Untergangs zu rechnen war, denn jedes Jahr soffen einige Kümos bei Unwetter ab. Jetzt musste Sicherheit vor Zeit gehen und auf Wetterbesserung gewartet werden. Dann lagen Dutzende Kümos im Schutz des Hafens längsseits zusammen und es wurde ein regelrechtes Familientreffen. Die Kapitäne und Steuerleute, die sich untereinander kannten, besuchten sich gegenseitig, und es wurde furchtbar getratscht und gesoffen. Auch wir Mannschaftsleute besuchten uns gegenseitig unter der Back und zogen über unsere Vorgesetzten her. Wir verglichen die Verpflegung miteinander und endeten schließlich beim „Thema 1“, den Frauen. Dabei soffen wir je nach Jahreszeit Grog oder „Charly Peng“, billigen Schnaps, aus Tassen, denn Gläser gab es nicht unter der Back. Dazu sangen wir schmutzige und unanständige Lieder, bei denen sich die feinen Leute an Land bekreuzigt hätten. Die Kapitäne und Steuerleute sahen solche Besuche und Verbrüderungen nicht gerne, denn viele ihrer Schandtaten machten danach wie ein Lauffeuer an der Küste die Runde. Am nächsten Morgen hatten wir dann alle einen schweren Kopf und der Steuermann trieb uns, wenn nicht gerade Sonntag war, gnadenlos bei der Arbeit an. Aber auch der Alte und der Steuermann sahen sehr mitgenommen aus, was uns ein wenig mit Genugtuung erfüllte.
Dauerte der Sturm länger, gingen wir, die Bordwache ausgenommen, abends an Land, meistens in die „Kugelbake“. Ein anderes Ziel war das Lokal mit dem seriösen Namen „Stadt Hamburg“, das aber von anständigen Bürgern gemieden wurde und als berüchtigtes Seemannslokal keinen guten Ruf genoss. Es verkehrten dort hauptsächlich Fischdampfermatrosen, leichte Mädchen, Abschaum der Küste und Besatzungen der Kümos. Abends wurde die Kaschemme von mehr als hundert Leuten frequentiert und es ging hoch her. Viele dort verkehrende Mädchen arbeiteten in den Fischfabriken und mussten am nächsten Morgen wieder zur Arbeit. Manche fanden sich auch morgens an Bord eines Schiffes wieder. Manchmal kam es in der „Stadt Hamburg“ zu wüsten Massenschlägereien und wer schlau war, machte sich rechtzeitig aus dem Staub. Auch Schlägereien unter Damen kamen vor und ich habe selbst gesehen, mit welcher Erbitterung und Hass sie aufeinander losgingen. Da war nichts Menschliches mehr, da wurde gekratzt, gebissen, getreten, die Haare gerauft. Dazu gesellten sich die anfeuernden Kommentare und Rufe der angetrunkenen Gäste. Die Nachtwachen an Bord mussten bei so vielen versammelten Kümos
höllisch aufpassen, dass nicht die Schmeißleinen, Pützen ect. geklaut wurden, denn es galt nicht als unehrenhaft, dergleichen bei einem Nachbarschiff zu besorgen. Nur erwischen lassen durfte man sich dabei nicht, denn dann gab es eine Tracht Prügel durch die Besatzung des geschädigten Schiffes. War der Sturm vorbei, setzte sich die ganze Kümoflotte in Bewegung und lief in die Nordsee aus, was immer ein imposanter Anblick für die Landratten auf der Promenade war.
Für jeden gibt es ein erstes Mal, und auch ich verlor meine „Unschuld“ mit 16 Jahren an einem denkwürdigen Tag in Rotterdam. Wenn unser Schiff auch fast immer neue Ladung bekam, so kam es auch einmal vor, dass wir in Ballast nach Rotterdam gehen und dort auf Ladung warten mussten. Wir lagen an der Parkkaade und warteten auf Order von unserem Agenten. Während dieser Zeit durfte niemand das Schiff verlassen und die Maschine war immer klar zum Auslaufen. Denn, war unser Ladehafen bekannt, wurden sofort die Leinen losgeworfen und in See gegangen. Tagsüber waren wir meistens an Deck oder außenbords auf Stellagen mit Instandsetzungs- oder Malerarbeiten beschäftigt. Dabei beobachteten wir die vorbeipromenierenden Spaziergänger und besonders die jungen Mädchen. Die Leute blieben manchmal stehen und sahen uns bei der Arbeit zu oder fragten uns dies und jenes, und wir fühlten uns wie echte Stars. Kamen wir mit ein paar hübschen Mädchen ins Gespräch, vergaßen wir unsere Arbeit, bis uns der Steuermann wieder auf Vordermann brachte. War am Sonnabend bis 17.00 Uhr noch immer keine Order eingegangen, hatten wir, ausgenommen die Bordwache, bis Montag Landgang.
Abwechslung gab es in Rotterdam genug und wer sein Geld unbedingt durchbringen wollte, brauchte nur durch den Maastunnel auf die andere Seite der Maas nach Katenrecht zu gehen, das Pendant zur Reeperbahn in Hamburg-St.Pauli. War „Hein Seemann“ besonders leichtsinnig, versackte er in einer der berüchtigten Kaschemmen, etwa in „Walhalla“ und wurde mit einiger Wahrscheinlichkeit zusammengeschlagen und ausgeraubt. Ging er danach zur niederländische Polizei, hatte er doppeltes Pech, denn die war damals auf die Deutschen gar nicht gut zu sprechen und sperrte ihn erst einmal ein. Aber es gab auch gute Lokale, wie z.B. die „Victoria Bar“, wo „Hein Seemann“ auf seine Kosten kommen konnte. An einem solchen Sonntagnachmittag an der Parkkaade drückte mir der Alte in einem Anfall von Großmut 2 ½ Gulden in die Hand mit der Order, Daisy, unsere Hündin, ein wenig an Land spazieren zu führen.
Es war Spätsommer. Die Sonne schien. Mit einer Leine ausgerüstet gingen wir beide frohen Mutes an Land. Nachdem wir auf der Promenade hin- und hergelaufen waren, und Daisy sämtliche Laternenpfähle und Ecken nach Artgenossen beschnüffelt hatte, hielten wir Ausschau nach einem Eisstand, denn genau wie ich hatte Daisy eine sehr große Vorliebe für Eiscreme. Sie konnte Unmengen davon verschlingen. Die Portion kostete damals 50 Cent und wir mussten nur noch einen Stand finden. Da es mittlerweile langsam dunkel wurde und die Buden und Kioske geschlossen hatten, fiel mir nur noch das große Café im Park neben uns ein, welches bis Mitternacht geöffnet war. Dort gab es einen angeschlossenen Stand, der an Spaziergänger und Pärchen Limonade und Eiscreme verkaufte. Das Café war eines der besseren Etablissements mit einem großen Garten mit Tischen und Stühlen, wo die Gäste von schwarzgekleideten Kellnern bedient wurden. Aus dem Inneren tönte leise Tanzmusik und ich nahm an, dass dort auch getanzt wurde. In dem angeschlossenen Eisverkaufstand bediente eine große blonde junge Dame. Ab und zu kam ein Kellner zu ihr und holte eine Portion Eis für die Gäste im Inneren des Cafés. Ich bestellte bei ihr für Daisy und mich zu je 50 Cent eine Tüte Eis und nachdem Daisy auf zwei Beinen bei mir „Bitteschön“ gemacht hatte, fielen wir über unsere Portionen her. Ich weiß nicht, wer von uns beiden sein Eis zuerst verzehrt hatte. Jedenfalls bestellte ich uns eine zweite Portion, als die Bedienung mich in ziemlich guten Deutsch fragte, ob ich Deutscher sei. Als ich dies bestätigte, wurde sie sehr erregt und erzählte mir, dass ihre Eltern während des 2. Weltkrieges bei dem großen Bombenangriff auf die Altstadt durch die Deutschen umgekommen seien.
Sie steigerte sich in solche Erregung und Erbitterung, dass ein Kellner angelaufen kam und fragte, was los sei. Der Kellner war schon ein älterer und grauhaariger Mann in den Fünfzigern, der ausgezeichnet deutsch sprach. Er fragte mich, wie alt ich sei und als er erfuhr, dass ich erst 16 Jahre zählte, machte er ihr klar, dass ich damals ein kleiner Junge von vier Jahren gewesen sei und gewiss nicht für den Tod ihrer Eltern verantwortlich zu machen sei. Als er mich nach meinen Eltern fragte und erfuhr, dass ich Vollwaise und meine Mutter schon ein Jahr nach meiner Geburt gestorben sei, mein Vater als Soldat gefallen war, schüttelte er den Kopf. „Weißt du was, „Meisje“, wandte er sich an die junge Dame, „im Grunde genommen seid ihr beide Opfer des Krieges. In einer Stunde wird die Bude sowieso dicht gemacht. Ich löse dich jetzt ab, und du und der Junge geht irgendwohin und trinkt eine Limonade oder esst ein Eis zusammen und erzählt euch was.“ Sie übergab diesem bemerkenswerten Mann die Kasse und wir machten uns auf den Weg in Richtung Jachthafen, wo noch einige Straßencafés und Lokale offen hatten und wo man draußen an den Tischen sitzen konnte. Sie fragte mich unterwegs, was ich denn in Rotterdam machen würde und ich erzählte ihr, dass ich Seemann sei und als Schiffsjunge auf einem Kümo fahre, das an der Parkkaade läge. Wir lägen dort auf Abruf und ich hätte die Order bekommen, unseren Bordhund auszuführen.
Unterwegs hatte ich Zeit, sie zu betrachten und so ist sie mir in Erinnerung geblieben: Ende zwanzig mit einer guten Figur, hübschem Gesicht und freundlichen blauen Augen, blond, schlank und sehr gebildet. Sie war etwas größer als ich und hatte alles, wovon ein junger Seemann nur träumen konnte. Als wir uns einem der gemütlichen Cafés näherten, kam ich in große Verlegenheit, denn ich hatte von den 2 ½ Gulden, die der Alte mir gegeben hatte, nur noch ½ Gulden, also 50 Cent übrig. Damit konnte ich keine Dame einladen. Daisy, die Eis witterte, zog nun ganz wild an der Leine und ich wurde noch verlegener, bis „Meisje“, das holländische Wort für Mädchen, mich fragte: „Was ist denn mit dir los, Seemann, stimmt etwas nicht?“ Ich druckste herum und gestand ihr schließlich verlegen, dass ich nur noch 50 Cent hätte und dies für uns drei doch wohl etwas zu wenig sei. Darüber musste sie herzlich lachen und sagte: „Da muss wohl die reiche Dame den armen Schiffsjungen und den armen Bordhund einladen.“ Ich berichtete ihr, wie ich bei meinen Großeltern und meiner Tante aufgewachsen war und wie es bei uns an Bord zuging. Sie erzählte mir, wie sie bei dem großen Bombenangriff auf Rotterdam, bei dem ihre Eltern ums Leben gekommen waren, bei ihrer Tante zu Besuch gewesen war und vom Tod ihrer Eltern später erfahren habe. Ihre Eltern wären bis zur Unkenntlichkeit verbrannt gewesen, und auch sie sei von ihrer Tante großgezogen worden.
Daisy und ich hatten jeder eine riesige Portion Eis gegessen, während „Meisje“ nur eine Limonade getrunken hatte. Die Zeit verging wie im Fluge. Als wir aufbrachen, war es schon um Mitternacht, aber wir hatten es nicht sehr weit zu ihr nach Hause. Es war eine eigenartige Situation, zwei Menschen und ein Hund in einer großen Stadt, die sich vorher nie gesehen hatten, die aber durch einen merkwürdigen Zufall an diesem Tag zusammengefunden hatten. Ich schildere dies alles so ausführlich, weil dieser Tag in meinem Leben einen bleibenden Wert in meinen Erinnerungen hat, den ich nie vergessen werde. „Meisje“ lebte in einer großen Wohnung mit hohen Fenstern. Sie hatte sie von ihrer Tante geerbt. Ehrfürchtig betrachtete ich das große Sofa, die antiken Möbel im Wohnzimmer, die alten Gemälde an der Wand, das große Bett im Schlafzimmer. Im Vergleich mit unserem winzigen Logis unter der Back kam ich mir in dieser Wohnung wie in einem Palast vor. Daisy, von dem vielen Eis ermattet, ließ sich auf einem der weichen Sessel nieder und war kurz darauf eingeschlafen. „Meisje“ kochte uns starken Tee und fragte mich, wie ich an Bord genannt werde. Ich erzählte ihr, dass Schiffsjungen an Bord nicht mit Namen gerufen werden, sondern allgemein Moses. Da wir aber schon einen solchen hätten, würden mich alle „Seemann“ nennen. Nur der Steuermann nannte mich aus einem mir unerklärlichen Grund „Edsche“.
Sie sagte mir, dass ihr Moses am besten gefiele und fragte mich, ob ich als Seemann schon viele Mädchen geküsst habe. Um meine Männlichkeit zu beweisen, gab ich natürlich furchtbar an, was für ein Toller Kerl ich manchmal sei. Sie lachte mich an und sagte plötzlich: „Dann küss mich doch, Moses. Aber irgendwas machte ich dabei verkehrt, denn sie lachte entzückt und sagte wörtlich: „Aber doch nicht so, Moses. Das müssen wir erst richtig lernen.“ Sie war eine gute Lehrmeisterin und mir tat sich eine Welt auf, von der ich immer nur an unserer Back (Tisch) von den anderen beim „Thema 1“ gehört hatte, aber bislang nie selbst erleben durfte. „Meisje“ brauchte mich wegen meiner jugendlichen Unschuld und ich sie wegen ihrer fraulichen Reife und Erfahrung. Es war für mich wie ein Traum. Aber nach jedem Traum gibt es ein Erwachen und als ich irgendwann in der Nacht aufwachte, dachte ich mit Schrecken an den Alptraum, der mich an Bord erwartete. Der Gedanke an den Alten, der auf seinen Hund und mich wartete, machte mich ganz krank. Ich weckte Daisy, die ganz fest schlief, leinte sie an und „Meisje“, die inzwischen wach war, brachte mich zur Tür. Dort küsste sie mich und sagte: „Moses, wenn du morgen noch hier bist, komm bitte wieder. Ich brauche dich, ich brauche dich wirklich, versprich es mir. Wenn ihr auslaufen solltet, so versprich mir, dass du mich, wenn dein Schiff wieder nach Rotterdam kommt, sofort besuchst.“ Ich versprach es ihr, aber wie das Schicksal es wollte, kamen wir nicht wieder nach Rotterdam, und ich sollte sie nie wiedersehen.
Mit bangem Gefühl machte ich mich mit dem Hund auf den Weg zum Schiff und richtig, ich hatte die Gangway nicht ganz betreten, als der Alte wie ein böser Giftzwerg aus dem Ruderhaus geschossen kam und schrie: „Daisy, ist dir auch nichts passiert?“ Dann kam ich dran: „Wo kommst du denn her, du Wichskopf“, brüllte er mich an, „weißt du überhaupt, wie spät es ist? Ich erzählte ihm, dass wir uns in der Innenstadt verlaufen und erst jetzt den Weg zurückgefunden hätten. „Verlaufen“, schrie er, „Mensch, du stinkst wie eine indische Tempelhure. Du hast doch wohl nicht den Hund mit in den Puff genommen? Und dann mit entsetzter Stimme: „Du perverser Wichskopf, du hast doch den Hund beim Ficken zuschauen lassen. Mensch, der Hund stinkt ja nach Puff. Durch das Gebrüll des Alten fing Daisy furchtbar zu bellen an, und der Alte wurde immer wilder. Der Skipper einer britischen Jacht, die hinter uns lag, kam an Deck gestürzt, um zu sehen, was los war und schimpfte dann über den Alten wegen der nächtlichen Ruhestörung. Ich verzog mich, während der Alte mit dem Skipper diskutierte, unter die Back, wo die anderen noch alle wach waren. „Mensch Seemann, wo kommst du denn her?“, rief Günther. „Der Alte spielt schon die ganze Nacht verrückt. Alle Augenblicke kam er hereingestürzt und schrie: „Hoffentlich ist Daisy nichts passiert!“ Hundepint wollte von mir wissen, bei welcher Nutte ich geschlafen hätte, aber ich blieb bei meiner Darstellung, dass ich mich verlaufen hätte, was mir aber keiner abnahm. Am nächsten Morgen kam komischerweise nichts danach und der Alte schnitt das Thema nicht wieder an. Nur der Steuermann fragte mich lüstern: „Na Edsche, hast du einen weggesteckt? Hat sie wenigstens einen schönen Titt gehabt?“ Ich aber blieb bei meiner Geschichte, dass ich mich verlaufen hätte.
Gegen Mittag bekamen wir Order für einen neuen Ladehafen und liefen gleich danach aus. Ich sollte „Meisje“ also nicht wiedersehen. Waren wir bislang alle Augenblicke nach Rotterdam gekommen, fuhren wir, so wollte es das unabänderliche Schicksal, nie wieder hin. Es sollte für mich und „Meisje“ nur diese eine Nacht gegeben haben.
Die Zeit verging, und eines Tages musterte der befahrene Moses ab und ein neuer Schiffsjunge mit Namen Peter kam an Bord. Somit wurde ich dienstältester Moses, behielt aber meinen Spitznamen „Seemann“. Peter war unbefahren und musste nun die gleiche bittere Anfangszeit durchstehen wie ich zuvor. Auch unsere üblichen Neckereien musste er über sich ergehen lassen, etwa den Auftrag, den „Kompassschlüssel“ zu holen, den es natürlich nicht gab. Oder er musste nach einer ominösen „Postboje“ Ausschau halten. Peter war ein dunkelhaariger kräftiger Bursche von 17 Jahren, den nichts aus der Ruhe bringen konnte und der ein unwahrscheinlich dickes Fell hatte. Den konnten selbst der Alte und der Steuermann nicht erschüttern.
Ich lernte inzwischen alle seemännischen Arbeiten an Deck, konnte Segel nähen, Tauwerk und Draht spleißen und sogar die Hauptmaschine und die Motorwinden „anschmeißen“. Letzteres war im kalten Winter eine umständliche Arbeit, die wir alle hassten. Sollte etwa im frostigen Winter um 8 Uhr mit den Winchen, wie die Motorwinden seemännisch hießen, gearbeitet werden, mussten wir bereits um 6 Uhr aufstehen und kochendes Wasser in die Kühlwassertanks schütten. Durch besonders brennende Lunten, die wir „Zigaretten“ nannten, und langes Drehen mit der Handkurbel musste dann der Motor gestartet werden. Es konnte unter Umständen sehr lange dauern, bis der Motor in der Kälte endlich ansprang. Manchmal federte die Kurbel plötzlich zurück und man bekam einen heftigen Schlag, der, wenn man nicht aufpasste, einem den Arm brechen konnte. Als Moses waren wir mächtig stolz, wenn es uns entgegen den gesetzlichen Bestimmungen erlaubt wurde, die Winden zu bedienen. Diese Arbeit war in der Regel nur Vollgraden gestattet.
Wurde mit „eigenem Geschirr“, also den Ladebäumen des Schiffes gelöscht oder geladen, mussten zwei Mann an jeder Seite an den Geien (eine Art Flaschenzüge) stehen und den Ladebaum in die Mitte der Luke schwingen. Der Mann an der Winde fierte (senkte) das Stahlseil wie bei einem Kran mit dem Haken in den Laderaum. War die Last dort angeschlagen, wurde sie nach oben gehievt, bis sie frei über der Luke hing. Nun wurde der Ladebaum durch die Geien per Hand durch zwei Leute nach außenbords geschwenkt bzw. gezogen, wobei die Gei innenbords langsam gefiert (in diesem Fall vorsichtig nachgegeben) werden musste. Schwebte die Last außenbords, wurde sie mit der Winde gefiert und von den Hafenarbeitern an Land abgeschlagen. Der Ladebaum wurde dann ohne Last mittels der Geien wieder innenbords geschwenkt. Der Vorgang wiederholte sich solange, bis das Schiff gelöscht war. Für die Leute an den Geien war es harte Knochenarbeit, und meistens mussten wir Junggrade die Geien bedienen. Meistens stellte das Schiff beim Lade- und Löschbetrieb die Winden- und Geienbedienungen selber. Von den Leuten an den Motorwinden forderte es höchste Konzentration, die bis zu 1 ½ Tonnen schweren Lasten sicher an Land oder Schiff zu bringen.
Passte der Winchmann einmal nicht auf und die Last fiel herunter, konnte es, vom hohen Sachschaden einmal abgesehen, zu tragischen Folgen kommen und auch Menschenleben gefährden. Besonders im Winter bei eisiger Kälte hatte man nach acht oder zwölf Stunden Arbeit an den Winchen kein Gefühl mehr in den Fingern. Darum löste man den Windenmann alle zwei Stunden für zehn Minuten ab, wobei meistens der Alte oder den Steuermann solange einsprangen. Auch wir Schiffsjungen mussten, wenn wir an den Geien standen, höllisch aufpassen, dass der Ladebaum mit der Last nicht außer Kontrolle geriet und gegen den Mast schwang, denn daraus konnten sich böse Konsequenzen ergeben, von der körperlichen Anstrengung, die das Bedienen der Geien erforderte, ganz zu schweigen. Die meisten von uns hatten keine richtige Winterkleidung. Wir trugen fast alle Gummistiefel, die wir mit Papier und Lumpen ausgestopft hatten und froren furchtbar. Ging ich mit dem Alten im Winter bei Nebel Seewache, stand er am Ruder und ich sechs Stunden als Ausguck vorne auf der Back. Ich habe später in meinem Leben nie wieder so gefroren, wie in der Zeit als Moses. Erst später als Jungmann konnte ich mir einige gebrauchte Wintersachen kaufen.
Meine damalige Heuer betrug, alles inklusive, 60 Mark im Monat. Eine gute Hose kostete über 50 Mark. So kann man sich vorstellen, wie ich herumlief. Da der Eigner wegen meines abgerissenen Aussehens um seinen Ruf fürchtete, schenkte er mir ein paar abgetragene Kleidungsstücke und Schuhe. Der Alte behielt meine Heuer für mich ein und sorgte dafür, dass ich mir davon Arbeitskleidung (!) und andere wichtige Utensilien kaufte. Ich bekam dann mal 20 Mark für den „Putzbüttel“ (Friseur), für Zahnpasta, Socken ect. und musste ihm die gekauften Sachen vorzeigen. Manchmal, wenn er gute Laune hatte, gab er mir am Monatsende großzügig 10 Mark Taschengeld, die ich nach eigenem Belieben durchbringen durfte.
Einen Tag vor Heiligabend, wir lagen in Hamburg, musterten „Hundepint“ als Leichtmatrose und Günther als Matrose ab. Sie hatten ihre Zeit voll und wollten nach der Weihnachtszeit auf Große Fahrt gehen. Mir tat es leid, dass sie gingen, denn beide hatten sich als großartige Kameraden erwiesen, und vor Günther hatten selbst der Alte und der Steuermann einen gewissen Respekt, so dass sie sich ihm gegenüber nicht alles erlaubten. Ich habe beide nie wiedergesehen. Günther soll später das große Kapitänspatent gemacht haben und Lotse geworden sein. Von Manfred alias „Hundepint“ hieß es, er sei auf der Reeperbahn gestrandet. Da das Schiff über die Feiertage in Hamburg liegen bleiben sollte, gingen der Alte und der Steuermann die Zeit über zu ihren Familien nach Hause. Daisy sollte die Zeit bei unserem Eigner verbringen. Nur wir beiden Schiffsjungen mussten an Bord verbleiben. Der Eigner gab jedem von uns einen mickrigen bunten Teller und 10 Mark mit der Mahnung, ja gut auf das Schiff aufzupassen. Es war schon ein eigenartiges Gefühl, als wir zwei Mosese am Heiligen Abend mutterseelenallein vorne in unserem Logis unter der Back bei Petroleumlicht saßen. Wir dachten an die vielen „anständigen Leute“ an Land, die jetzt gewiss unter dem Christbaum ihre Geschenke auspacken und anschließend ihren Weihnachtsbraten verzehren würden. Auch hatten wir furchtbaren Kohldampf, denn außer Kommissbrot, Heizer-Jam, Margarine, etwas Käse und Dauerwurst, lag in der Kombüse nur noch ein vorgefertigter winziger „falscher Hase“, der für drei Mahlzeiten reichen musste.
Bis auf das Ruderhaus, den Maschinenraum und die Kombüse war achtern alles abgeschlossen, auch die Speisekammer an der Steuerbordseite. Peter und ich erinnerten uns an die etwa zwanzig schönen kleinen geräucherten, jeweils ca. 500 g schweren Speckseiten, die an der Decke der Speisekammer an Haken hingen und uns einmal im Monat zu Plum un Klüten lecker mundeten. Wir erinnerten uns aber auch an das Bullauge der Speisekammer, welches immer offen stand, aber durch zwei senkrechte Metallstäbe gesichert war. Da überkam uns trübselig Sinnenden am Heiligen Abend ein ganz unheiliger Gedanke: Es müsse doch möglich sein, von außen mit einer Stange oder ähnlichem Werkzeug die Speckseiten vom Haken zu liften und durch die Lücke zwischen die Gitterstäbe hindurch nach außen zu ziehen. Die Speckseiten hatten eine Dicke von 5 bis 6 cm und hingen mit ihren Bindfadenösen an den Haken, während die Lücke zwischen den Gitterstäben 10 cm betrug. Unser Hunger war inzwischen so groß geworden, dass wir unverzüglich zur Tat schritten.
Zunächst nahmen wir einen Besenstiel, schraubten einen Kleiderbügelhaken mit seinem Gewinde auf den Stiel und hatten so eine Angel. Der zweite Schritt war etwas schwieriger, da es stockdunkle Nacht war und unser Schiff außer den zwei vorgeschriebenen mit Petroleum betriebenen Hafenlampen am Steven und am Heck völlig im Dunkeln lag. Nur an der Gangway hing noch eine Petroleumfunzel, die man aber vergessen konnte. Wir hängten bei dieser Dunkelheit unsere große Malerstellage, die wir von Deck holen mussten, außenbords direkt unter das Bullauge der Speisekammer. Ausgerüstet mit unserer provisorischen Angel und unserer Brückentaschenlampe machten wir uns ans Werk. Es ging einfacher als wir dachten. Während ich auf der Stellage mit der Taschenlampe leuchtete, angelte Peter neben mir vier ansehnliche Speckstücke und eine große Rauchwurst vom Haken. Gott sei Dank, feierte auch die Wasserschutzpolizei, die sonst ihre Streife im Hafen fuhr, wahrscheinlich irgendwo das Weihnachtsfest. Wir zündeten unseren Kohleherd in der Kombüse an und nie wieder hat mir ein „Weihnachtsbraten“ besser geschmeckt, als an jenem Heiligen Abend des Jahres 1952. Unser Mundraub fiel nie auf, und wenn, so wurde niemals darüber gesprochen, denn auch der Eigner bediente sich manchmal im Hafen aus der Speisekammer.
Nach den Feiertagen kamen der Alte und der Steuermann wieder an Bord zurück, aber da wir erst im neuen Jahr eine Ladung bekommen sollten, verschwanden sie meist schon mittags. Der Steuermann sah ziemlich zahm und abgekämpft aus, was selbst dem Alten auffiel, denn er sagte einmal: „Mensch, seine Alte muss ihn ja jeden Abend ganz schön rannehmen. Wenn wir hier auslaufen, kann die nachher bestimmt 14 Tage lang kein klares Wasser mehr pissen.“
Auch der Eigner ließ sich ein paar mal an Bord sehen. Er brachte immer seinen Anhang oder einige Gäste mit, und Peter musste dann einen „guten Kaffee“ kochen. Einmal kamen auch seine Tochter und deren Freundin, die uns wie zwei exotische Tiere betrachteten. Auch Peter und ich bestaunten die beiden wie Lebewesen aus einer uns unbekannten fremden Welt. Sie waren beide sehr elegant gekleidet und hatten jenen Ausdruck in den Augen, mit denen früher vielleicht die adligen Feudalherren ihre Stallburschen oder Leibeigenen betrachtet haben mögen. Wir beide sahen aber auch sehr kurios aus. Ich trug eine total abgerissene schwarze speckige Hose, deren Schlitz mit einer Sicherheitsnadel zusammengehalten wurde, dazu einen blauen ausgefransten, von Motten zerfressenen Pullover mit Rollkragen, den Günther an Bord gelassen hatte, von meinen Schuhen, die an den Hacken mit Segelgarn repariert und mit Farbe beschmiert waren, gar nicht zu reden. Wir trugen unsere Schuhe an Deck bei der Arbeit, auch beim Malen und gingen damit ebenso beim Landgang in die Stadt. Aber was konnte man sich als Moses schon für 50 Mark Monatsheuer netto kaufen? Unser Anblick muss selbst den Eigner geschmerzt haben, denn am nächsten Tag kaufte er uns jedem eine Latzhose und vernünftiges Schuhwerk. Seine Tochter war eine große schlanke dunkelhaarige 19jährige Dame, die Freundin das blonde Gegenstück. Beide sprachen gewählt mit unterkühltem Ton und waren für uns unerreichbar.
Das Vergnügungsviertel von St. Pauli war damals, im Gegensatz zu heute, ein magnetischer Anziehungspunkt für Seeleute. Trifft man da heute nur noch selten einen Seemann, so verkehrten dort damals in vielen Bars und Kaschemmen in der Mehrzahl Seeleute. Natürlich gingen auch viele Hamburger und Touristen über die Reeperbahn, aber keine Berufsgruppe wurde so mit ihr identifiziert, wie die des Seemanns. Zahllose Lieder handeln vom Seemann und der Reeperbahn. Viele damalige Reedereibesatzungen hatten ihre Stammkneipen, wo sie bei den Wirten und Mädchen bekannt waren. Wenn sie dort „einen draufmachten“, wurden sie nicht ganz so skrupellos ausgenommen, wie es einem einzelnen und fremden Seemann auf St. Pauli durchaus passieren konnte. Etliche Seeleute schickten auch ihre Heuer an den Stammkneipenwirt, wo sie redlich verwahrt wurde. Ein mir bekannter Matrose sandte seine Heuer jahrelang an die Wirtin der „Bunten Kuh“, einer echten Seemannskaschemme mit leichten Damen und allem „drum und dran“. Musterte er ab, wohnte er auch dort, bis er alles durchgebracht hatte. Dann ging er wieder auf See. Auch eine Lebenseinstellung!
Auf St. Pauli bekam man für sein Geld etwas geboten und die Preise waren, je nach Anspruch und „Qualität“, gestaffelt, so dass ich mir dort auch als Moses ab und zu ein Bier leisten konnte. Die von mir bevorzugte Kneipe war damals der „Silbersack“, ein echt schräges Seemannslokal. Es war abends immer proppenvoll von Seeleuten, leichten Mädchen (letztere haben keine Zuhälter), Nutten, Hafenarbeitern, allerhand Spitzbuben und Ganoven. Auf einem kleinen Podium spielte meist eine Dreimannkapelle Seemannslieder und die letzten Ohrwürmer. Es wurde getanzt, gesoffen, geprügelt und gehurt. Der Türsteher war ca. zwei Meter groß und wog nicht weniger als 130 kg. Fing jemand Streit an, ging er meistens dazwischen, und der Störenfried landete auf der Straße. Blieb man nüchtern und benahm sich anständig, passierte einem selten etwas, und man konnte die Idylle dort genießen. Ein Glas Bier kostete im „Silbersack“ 40 Pfennig - im „normalen“ Lokal 28 Pf. - und die Musik gab’s gratis. Wer allerdings seine Heuer in bar bei sich trug, lebte auch dort gefährlich. Ließ er sich von einem Mädchen überreden, in eine andere Kneipe oder zu ihm nach Hause zu gehen, konnte es schon passieren, dass er später in den Ruinen, die es damals noch überall gab, ohne Geld und Seefahrtbuch aufwachte. Man hatte ihm „K.O.-Tropfen“ ins Getränk getan oder eins über den Schädel gezogen. Das Geld konnte man zur Not verschmerzen, der Verlust des Seefahrtbuches brachte jedoch allerlei Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten mit sich. In Unterweltkreisen waren Seefahrtbücher damals sehr gefragt und wurden mit bis zu 300 DM bezahlt. Viele Ganoven konnten mit einem deutschen Seefahrtbuch auf ausländischen Schiffen untertauchen. Da ich nur Moses war, war mein Seefahrtbuch für diese Kreise jedoch uninteressant.
Während unserer Liegezeit über die Weihnachtsfeiertage ging ich abends oft zur Reeperbahn, wo man mir trotz meiner Jugend immer ausschenkte. Ich brauchte nur zu sagen, ich sei Seemann und mein Seefahrtbuch vorzeigen. So kam ich meistens nachts ziemlich angeheitert an Bord, und am nächsten Tag ging alles wie gewohnt weiter. Nur in der „Kleinen Marienstraße“, einer Bordellstraße, durfte ich mich mit meinen 17 Jahren nicht aufhalten, da sich dort ständig die Streife sehen ließ und man des Platzes verwiesen wurde. Nachts kümmerte sich niemand um einen.
Im neuen Jahr bekamen wir einen neuen Leichtmatrosen, der Gerhard hieß. Er war 18 Jahre alt, blond und nicht besonders kräftig, aber ungemein zäh. Für einen Ostfriesen sprach er sehr viel und hatte einige Macken. Eine dieser Macken bestand darin, dass er seine Pudelmütze, außer beim Essen und Schlafen, ständig auf dem Kopf hatte. Er war nicht nur ein ausgezeichneter Seemann, sondern entsprach ganz dem Klischee, das sich die Leute an Land von einem Seemann machen. Dazu gehörten seine blaue Pudelmütze, Matrosenbluse und Seestiefel. Mit seinen blauen Augen war er der Schwarm vieler Mädchen, aber wie er uns erzählte, liebte er nur eine und der blieb er auch die ganze Zeit treu. Dies unterschied ihn wiederum von der Vorstellung der Landratten vom typischen „Hein Seemann“. Aber dafür war er äußerst trinkfest und ging keinem Streit aus dem Wege.
An einem kalten Morgen liefen wir bei Schneetreiben und kaltem Wind aus Hamburg aus. Wir sollten in Nordenham an der Weser, südwestlich von Bremerhaven, Koks laden. Wir mussten die Ladung also wieder selbst trimmen. Da Koks auch zusätzlich als Decksladung befördert wurde, musste vor dem Laden ein „Kokskäfig“ aus Maschendraht aufgebaut werden. Mit nur einem Leichtmatrosen und zwei Schiffsjungen total unterbesetzt, fingen wir gleich nach dem Auslaufen bei dichtem Schneetreiben und eisiger Kälte mit dem Käfigbau an. Zwei Mann mussten dazu auf jeder Seite des Schiffes ca. drei Meter hohe schwere Holzbalken als Stützen im Abstand von zwei Metern auf jeder Seite des Schiffes an der Reling aufstellen und sichern. Während Gerhard und ich auf der einen und der Steuermann mit Peter auf der anderen Seite arbeiteten, stand der Alte die ganze Zeit allein auf der Brücke am Ruder und navigierte das Schiff die Elbe hinunter. Er hätte sich einen Lotsen nehmen können, aber dann hätte er nicht die Hälfte des Lotsengeldes bekommen, welches ihm der Eigner bezahlte, damit er alleine fuhr. Unsere Arbeit an Deck war mühselig. Wir mussten mit zwei Mann die schweren Holzstützen mit dem unteren Ende in extra an Deck eingeschweißte Halter stecken und an der Reling mit einer Klammer sichern. Während der eine die Stütze in aufrechter Position in der Halterung hielt, sicherte sie der andere durch die erwähnte Klammer an der Reling.
Wir froren dabei jämmerlich an den Händen und hätten uns sehnlichst Arbeitshandschuhe gewünscht, wie sie auf Großer Fahrt üblich waren. Aber in der Küstenschifffahrt galten Arbeitshandschuhe als unseemännisch, weil damit angeblich bei der Arbeit das Gefühl verloren ging. Nur „Dampfermatrosen“, wurde uns verächtlichmachend erklärt, trügen Handschuhe und diese seien keine echten Seeleute. Dass man sich aber ohne Arbeitshandschuhe an den Drähten durch „Fleischerhaken“ die Hände schwer verletzen oder an Holzplanken Splitter einreißen konnte, wurde völlig ignoriert und solche Verletzungen bewusst in Kauf genommen. Wir jedenfalls hätten in dieser eisigen Situation alles für ein Paar Handschuhe gegeben. Waren die Stützen gesetzt, wurde ein enger Maschendraht an beiden Seiten von vorne nach hinten über die ganze Länge an die Stützen genagelt. Das Ganze sah dann wie ein riesiger Käfig aus. Die Arbeit war während der Fahrt besonders gefährlich, da man dazu auf die Reling steigen musste, um den Draht so hoch wie möglich an die Stützen zu nageln. Da man ungesichert wie ein Artist auf der Reling stand und an den Stützen kaum Halt fand, bestand die große Gefahr, außenbords zu fallen. Bei der eisigen Temperatur des Wassers, der schlechten Sicht und dem umständlichen Rettungsmanöver hätte man im Ernstfall wohl kaum eine Überlebenschance gehabt. Spät am Abend wurden wir fertig. Die letzten Meter Draht hatten wir noch bei voller Dunkelheit an die Stützen genagelt.
Da wir bei Ankunft in Nordenham sofort laden sollten, hatten wir fast ohne Unterbrechung durchgearbeitet. Auch das Kochen fiel aus, da ja jeder Mann an Deck gebraucht wurde. Zu Mittag und am Abend gab es, wie in solchen Situationen üblich, pro Mann eine Dose Ölsardinen und etwas Corned Beef mit Brot. Als wir gerade fertig waren, befanden wir uns auch schon in der „Alten Weser“ und das Schiff fing bei aufbrisendem Nordwestwind und dem flachen Wasser unter dem Kiel furchtbar an zu schaukeln und legte sich teilweise bis zu 30 Grad über. Dadurch mussten wir vorne unter der Back unseren Kachelofen löschen. Todmüde und durchgefroren legten wir uns, so wie wir waren, in den warmen Maschinenraum auf die Flurplatten zum Schlafen nieder. Zwischendurch lösten wir uns am Ruder ab, bis wir bei Tagesanbruch Bremerhaven erreichten, wo das Schiff wieder ruhig lag. Sofort begannen wir mit dem Öffnen der Ladeluken. Wir hatten alle nicht mehr als zwei Stunden geschlafen, und auch der „Muckefuck“ machte uns nicht munter.
Da Nordenham nur etwa 1 ½ Stunden von Bremerhaven entfernt liegt, trieb uns der Steuermann erbarmungslos an. Wir mussten die Lukenkeile herausschlagen, die Schalklatten herausnehmen, die schweren Verschlussbügel wegräumen und die steifen Persenninge zusammenrollen, wobei auf jede Lage des Frostes wegen Salz gestreut wurde. Kaum war der letzte Lukendeckel abgehoben, als wir auch schon in Nordenham anlegten, einer kleinen Stadt in Niedersachsen mit einem riesigen Kohlehafen direkt an der Weser. Die gewaltigen Krananlagen konnten mit ihren großen Greifern ganze Eisenbahnwaggons auf einmal be- oder entladen. Theoretisch hätte ein Kran unser Schiff in zwei Stunden beladen können, wenn das Trimmen und Schließen der Luken nicht so zeitaufwendig gewesen wäre. Der Alte rechnete mit etwa sechs Stunden Liegezeit, bis wir wieder ablegen konnten. Kaum hatten wir die letzten Scherstöcke mit unseren Ladebäumen an Deck gehievt, als auch schon der erste Greifer seinen Inhalt in den Laderaum schüttete. Nach jeder Greiferfüllung konnte man sehen, wie das Schiff tiefer ins Wasser tauchte. Da die Kräne stationär waren, mussten wir das Schiff erforderlichenfalls mit unseren Leinen vor- und zurückziehen, damit der Kran die Ladung gleichmäßig verteilen konnte. Es dauerte dann auch nicht mehr lange, bis wir, mit Schaufel, Trimmblech und Kabellampe ausgerüstet zum Trimmen unter Deck verschwanden. Tauchten wir wieder an Deck auf, klopfte der Alte oder der Steuermann mit einem Besenstiel das Deck ab und wenn eine Stelle hohl klang, jagte er uns wieder hinunter.
Nach dem Trimmen mussten wir, so ausgelaugt und erschöpft wir auch waren, die Luken über dem vollen Laderaum wieder mit dem bekannten Aufwand seefest verschließen, um Platz für die Deckslast zu schaffen. Da wiederum Zeit Geld kostete, weil der Kran warten musste, trieben uns der Alte und der Steuermann weiterhin erbarmungslos an. Die ganze Zeit gab es für uns weder Pausen noch Essen, alles musste zurückstehen. Nach einigen Greiferinhalten war unser Schiff bis auf Winterlademarke voll beladen. Nachdem wir den Koks an Deck mit Schaufeln eben getrimmt und die Ladebäume heruntergedreht hatten, verließen wir auch schon den Ladeplatz in Richtung See via „Alte Weser“ und Elbe zum Nord-Ostsee-Kanal und bis auf den Mann der Wache, der das Schiff restseeklar machte, gingen wir übrigen Besatzungsmitglieder unter Deck, der Steuermann in seine warme Kammer und wir wieder in den warmen Maschinenraum, wo wir uns auf den Flurplattenboden fallen ließen und sofort einschliefen. Anlässlich des Wachwechsels gab es eine Kleinigkeit zu essen und ausnahmsweise eine Tasse echten Kaffee.
Irgendwie mussten wir eine günstige Tide erwischt haben, denn kurz vor Ende meiner Wache erreichten wir Brunsbüttelkoog und liefen auch gleich in die Schleuse ein. Dort erfuhren wir auch, dass unser Löschhafen Nykøbing in Dänemark sein sollte. Wir waren immer noch nicht gewaschen und müssen mit unseren schwarzen Gesichtern für die Leute an der Schleuse zum Fürchten ausgesehen haben. Der Alte nahm einen Kanallotsen und teilte sich mit dem Steuermann die achtstündige Durchfahrt, während Gerhard und ich uns alle zwei Stunden beim Steuern ablösten. Peter hatte vorne den Ofen angezündet und endlich konnte ich mich waschen. Ich nannte es „Russisches Bad“ und man hatte nur eine Möglichkeit, das Bad einigermaßen angenehm zu überstehen. Da wir nur kaltes Wasser hatten, brachte ich 1 ½ Eimer voll davon und einen kleinen leeren Topf nach vorne. Mit dem kleinen Topf - ein größerer passte nicht auf unseren Ofen - machte ich mir heißes Wasser und schüttete es in den halbvollen Eimer, so dass das Wasser nicht mehr ganz so kalt war. Anschließend wusch ich mir mit dem lauwarmen Wasser die Haare und seifte meinen Körper gründlich ein. War ich eingeseift und das Haar gewaschen, goss ich den Rest lauwarmen Wassers mit dem Eimer über den Kopf und anschließend den vollen Eimer mit dem kalten Wasser hinterher. Trocknete man sich sofort hart ab und rieb anschließend seinen Körper tüchtig mit einem zweiten Handtuch, empfand man eine wohlige Wärme. Gleichzeitig fühlte man sich erfrischt und sah einigermaßen gewaschen aus. Unsere tägliche Wasserration zum Waschen bestand normalerweise nur aus einem vollen Eimer, den halben extra gab es nur nach dem Trimmen.
Nach der Passage des Nord-Ostsee-Kanals fing in der Ostsee der normale Bordbetrieb wieder an. Der Alte war zufrieden und guter Laune, denn er hatte in Nordenham die Trimmer gespart und außerdem zweimal die halbe Lotsengebühr kassiert. Es gab zur Feier des Tages Plum un Klüten und wir konnten uns die Bäuche wieder einmal richtig vollschlagen.. Es war die erste warme Mahlzeit nach dem Auslaufen aus dem Hamburger Hafen. Wir machten noch viele Kohle/Koks- und Getreidereisen, bei denen wir selber trimmen mussten, wobei ich das Trimmen des Getreides am unangenehmsten fand, da einem noch mehrere Tage danach die Brust und die Atemwege schmerzten.
Ich war jetzt mit fast acht Monaten Fahrzeit „vorne“ am längsten an Bord und kam mir unendlich „befahren“ vor. Hatte ich bislang vor Günther und „Hundepint“ gehörigen Respekt gehabt, so ließ ich mir von unserem neuen Leichtmatrosen Gerhard nichts mehr sagen. Irgendwann kam es dann in einem Hafen zum offenen Streit und hätte Peter uns nicht getrennt, hätte ich von Gerhard eine tüchtige Tracht Prügel bezogen. Wie erwähnt, war der Bursche ungewöhnlich zäh. So war nun die Rangordnung wieder klar. Aber Gerhard war trotz allem nicht Günther und wenngleich Peter und ich ihn als höheren Dienstgrad respektierten, war dies beim Alten und dem Steuermann nicht der Fall. Der Steuermann wurde immer unbeherrschter und der Alte noch maßloser. Herrschte früher noch ein einigermaßen erträglicher Ton an Bord, wurde jetzt, da Günther weg war, nur noch gebrüllt und gedroht. Kamen wir auch nur zwei Minuten zu spät an Deck, drehte der Steuermann durch und tobte fürchterlich. Der Alte ließ uns jeden Sonntag im Hafen im „Schiffsinteresse“ zutörnen (arbeiten) und drohte andauernd mit dem „Sack“.
Das war selbst Gerhard eines Tages zu viel. Als wir wieder einmal an einem Sonntag im Hafen im „Schiffsinteresse“ an der Kai außenbords malen mussten und uns dabei mit einigen Sonntagsspaziergängern unterhielten, brüllte uns der Steuermann vor einem großen Publikum fürchterlich an. Ich kann mich nicht mehr an die einzelnen Worte erinnern, aber dem Sinne nach lautete der Tenor, wir faulen Schweine sollten keine Volksreden halten, sondern zusehen, dass wir fertig werden. Da drehte unser Leichtmatrose durch und schrie noch lauter zurück: „Nun halt mal deine Schnauze, du Neandertaler, oder ich stopf dir den Pinsel ins Maul! Für mich ist hier morgen Feierabend an Bord, ich fahr doch nicht mit Psychopathen!“ Er warf seinen Pinsel hin und verschwand an Bord unter Deck. Der Steuermann war so verblüfft, dass er seinen Mund zu schließen vergaß und keine Erwiderung fand. Die vielen Spaziergänger, die das Schauspiel verfolgten, konnten selbst erleben, wie es bei der deutschen „christlichen Seefahrt“ zuging. Ich glaube nicht, dass Eltern ihren Kindern nach diesem Schauspiel raten konnten zur See zu fahren. Gerhard musterte tatsächlich am nächsten Tag ab und der Alte bestand aus gutem Grund nicht auf Einhaltung der 48stündigen Kündigungsfrist.
Wir waren jetzt nur noch zu viert an Bord unterwegs zu unserem nächsten Hafen, Hamburg, wo die Wasserschutzpolizei uns wegen Unterbesetzung festhielt, bis wir einen Matrosen und einen Leichtmatrosen angemustert hatten. Nun waren wir das erste Mal seit meiner Anwesenheit an Bord personell vorschriftsmäßig besetzt. Der Matrose, der erste Vollgrad, mit dem ich zu tun hatte, war Anfang dreißig und will vor dem Kriege als Steuermann gefahren und dann zur Marine eingezogen worden sein. Zusammen mit anderen Teilhabern hatte er nach der Währungsreform wohl eine Fruchtimportfirma gegründet und bis vor zwei Monaten ein gutes Leben mit eigenem Fahrer und Villa geführt, bis seine Kompagnons feststellten, dass er lastwagenweise Ladung zu seinen Gunsten verschoben hatte. Sie erstatteten Anzeige gegen ihn und da alle seine Konten bis zum Prozessbeginn gesperrt waren, erinnerte er sich, einmal zur See gefahren zu sein. Nun war er hier bei uns an Bord, um sich im gelernten Handwerk die nötigen Brötchen zu verdienen. Er musste wirklich eine „Wirtschaftsgröße“ gewesen sein, denn er zeigte uns Fotos, die ihn bei festlichen Anlässen und Banketts zusammen mit prominenten Politikern und Filmgrößen Arm in Arm zeigten. Darunter war auch eine sehr bekannte junge Schauspielerin, deren Film gerade in allen Kinos lief. Er war schlank, mittelgroß, sah gut aus und regte sich nie auf.
Der Leichtmatrose war 26 Jahre alt, hellblond, auch mittelgroß und athletisch gebaut. Er stammte aus Ostpreußen und hatte sich mit 17 Jahren freiwillig zu den Fallschirmjägern gemeldet. Bis zum Zusammenbruch hatte er mit seiner Truppe noch in Ostpreußen gegen die Russen gekämpft und sich vor der Gefangenschaft in den Westen retten können. Mit seinen blauen Augen und markantem gebräunten Gesicht sah er sehr gut aus und hatte eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem Filmschauspieler Hardy Krüger. Man hätte beide für Zwillingsbrüder halten können. Er war ruhig, sehr verschlossen und sprach wenig. Wir wussten kaum etwas über ihn, nur dass er seit 2 ½ Jahren zur See fuhr und nun hier bei uns an Bord Leichtmatrose war. Trotzdem war er ein guter Kamerad. Der Matrose tat sich am Anfang sehr schwer an Bord, verstand aber sein Handwerk und damit bewahrheitete sich die alte Volksweisheit, dass man, was man einmal gelernt hat, auch immer wieder verwerten kann. Auch unser Leichtmatrose war tüchtig in seinem Fach und immer ruhig und ausgeglichen. Beide tranken und hurten nicht und das „Thema 1“ war fortan an der Back tabu. Von den insgesamt 17 Monaten, die ich an Bord verbrachte, begann jetzt die angenehmste Zeit, die ich auf diesem Schiff erlebte. Der Steuermann hielt sich nach dem Vorfall mit Gerhard zurück, und auch der Alte wurde außergewöhnlich zahm. Wir machten Reisen nach England und Irland und es war das erste Mal, seit ich an Bord war, dass die Seefahrt mir Spaß machte.
Einmal lagen wir über das Wochenende bei Wexford in Irland an einer einsamen Kai, wo wir am Montag löschen und laden wollten. Kurz nach Mitternacht hörten wir an unserer Decke unter der Back in kurzen Zeitabständen klickende Geräusche, als ob jemand kleine Kiesel auf die Back warf. Der Leichtmatrose, Peter und ich stürzten an Deck und sahen im Mondschein drei junge Mädchen den einsamen Strand entlang davonlaufen. Wir drei sofort hinterher und wie bei der Lotterie griff sich jeder von uns eine. Meine war am weitesten gelaufen und als ich sie zu fassen bekam, stürzten wir beide in den weichen Sand. Ich sah im Mondschein ein weißes, blasses Gesicht mit großen Augen, roten Haaren und unter mir den hübschesten Mund. Wir schauten uns beide erstaunt an und lachten. Wahrscheinlich hatten wir beide das richtige Los der Lotterie gezogen. Auch meine beiden Kameraden mussten die richtige Wahl getroffen haben, denn als der Sonntagmorgen an diesem denkwürdigen Tag im Mai zu grauen begann, hatte jeder von uns seine Beute fest im Arm.
Als wir uns bei dem beginnenden Tageslicht alle zusammen betrachten konnten, mussten wir alle lachen, denn meine Kameraden und ich hatten außer unseren Unterhosen nichts weiter an. Wir waren so, wie wir in der Koje gelegen hatten, an Deck gestürzt. Meine Eroberung hieß Peggi, war 17 Jahre alt und für mich damals das schönste Mädchen der Welt. Der Leichtmatrose hatte die größte der drei Grazien erwischt. Sie war 18 Jahre alt, auch rothaarig, sommersprossig und ungemein gut proportioniert. Voller Bewunderung schaute sie immer wieder auf seine athletische Brust. Peter hatte die Kleinste der drei. Sie war 16 Jahre alt, schwarzhaarig und an allen Ecken rund. Als es schon hell wurde, bekamen die Mädchen plötzlich Angst, dass sie irgendwer sehen könnte, was damals in Irland für ihren Ruf fatale Folgen gehabt hätte. Sie erzählten uns, dass sie am Abend vorher zum Tanzen gewesen seien und da hier seit Jahren kein Schiff gelegen habe, hätten sie beschlossen, nach dem Tanzen unser Kümo anzusehen.
Wir verabredeten, uns am Abend bei einem alten Friedhof in der Nähe eines Dorfes wieder zu treffen. Dort würden sie an der alten Kapelle auf uns warten. Nachdem sie uns den Weg zum Treffpunkt noch einmal beschrieben hatten, verschwand unser Grazien-Tio in Richtung Dorf. Als wir drei frohen Mutes zu unserem Schiff zurückkehrten und - außer Peter, der ja bald seinen Küchendienst antreten musste - in unseren Kojen verschwanden, schlief unser Matrose noch tief und fest. Da am Sonntag nicht gearbeitet wurde, konnten wir - bis auf Peter - ausschlafen. Am Abend, kurz vor 21 Uhr, die Sonne ging schon langsam unter, machten wir drei uns auf den Weg zu unserem Rendezvous. Unser Matrose hatte freiwillig die Nachtwache übernommen, so dass diese Nacht uns gehörte. Wir hatten unsere schwarzen Nietenhosen mit den bunten Hosenaufschlägen an, die gerade große Mode waren und obgleich wir keinen Pfennig in der Tasche hatten, so waren wir doch jung, verwegen und strotzten nur so vor Selbstvertrauen. Die Straße von unserer abgelegenen Kai zum Dorf war mehr ein Feldweg, der nur benutzt wurde, wenn alle Jubeljahre ein Schiff dort anlegte und so begegneten wir keiner Menschenseele. Rechts und links des Weges standen einige Bäume, sonst wuchs überall nur Heide, garniert von großen Steinbrocken.
Nach ca. 45 Minuten konnten wir in der Ferne das Dorf sehen, welches malerisch in einer Senke lag. Etwa zwei Kilometer vor dem Dorf wurde das Gelände rechts der Straße buschig, und ein Feldweg bog zu einer kleinen Kapelle mit Friedhof rechts von unserer Straße ab. Es war inzwischen kurz nach 22 Uhr geworden, fast genau der Zeitpunkt, an dem wir uns treffen wollten. Als wir die Kapelle erreichten, war auch die Sonne hinter dem Horizont verschwunden und wir hielten vergeblich Ausschau nach unseren Mädchen. Es wurde immer dunkler und der Ort immer unheimlicher. Wir bedauerten schon, nicht unsere Finnendolche mitgenommen zu haben, die wir sonst immer bei der Arbeit trugen. Messer hatte man damals immer bei der Arbeit dabei und ein alter Seemannsspruch lautete: „Ein Seemann ohne Messer ist wie eine Frau ohne...“ - Kurz vor 23 Uhr, wir wollten schon zurück an Bord gehen, tauchten unsere Mädchen dann doch noch auf. Sie hatten so lange warten müssen, bis die Eltern von Peters Freundin schlafen gegangen waren und konnten erst danach unbemerkt das Haus verlassen.
Es war völlig dunkel und wir saßen zusammen auf der Treppe der kleinen Kapelle, deren Tür offen stand. Nur das Licht der „ewigen Lampe“ am Altar schien zu uns herüber. Die Mädchen erzählten uns, dass selten jemand hierher käme, da auf der anderen Seite des Dorfes ein neuer Friedhof angelegt worden sei. Nur ein Mesner würde jeden Abend mit dem Fahrrad herkommen, um nach der „ewigen Lampe“ zu sehen. Peters Freundin, die gehört hatte, dass Seeleute gerne einen Schluck trinken, hatte einen „Flachmann“ mit „Red Breast“ mitgebracht, den sie aus den Vorräten ihres Vater ohne dessen Wissen hatte mitgehen lassen. Wir hatten von Bord genügend Zigaretten dabei, so dass es an diesem sonst so ruhigen und geheiligten Ort ziemlich lustig wurde. Es war übrigens das erste Mal in meinem Leben, dass ich Whisky trank. Peggi erzählte mir, sie arbeite in einer Bäckerei und müsse morgens immer sehr früh aufstehen. Das Mädchen unseres Leichtmatrosen war Näherin und Peters Sechzehnjährige ging noch zur Schule. Gegen Mitternacht verteilten wir uns auf dem Friedhof und vielleicht haben wir den Toten ein wenig Abwechslung bei ihrer ewigen Ruhe geboten. Es fiel mir dabei ein lateinischer Spruch ein, den ich irgendwo einmal gelesen und aufgeschrieben hatte: „Taceant colloquis effugiatrius. His locus est ubi gaudet succuree vitae.“ Sinngemäß übersetzt: „Hier ist der Ort, an dem die Toten sich erfreuen, den Lebenden zu helfen.“
Im Morgengrauen schlichen wir uns, nachdem wir uns mit unseren Mädchen für den Abend wieder am gleichen Ort verabredet hatten, zurück an Bord. Um 6 Uhr früh warf der Steuermann uns aus den Kojen, denn um 8 Uhr musste das Schiff klar zum Löschen sein, da um diese Zeit auch die Hafenarbeiter mit ihrem Bus aus Wexford ankommen sollten. Wir drei machten an Bord nicht den frischesten Eindruck und irgendwie ahnte der Alte, dass wir die Nacht nicht auf dem Schiff verbracht hatten, denn bei einer passenden Gelegenheit bemerkte er: „Mensch, ihr seid wohl heute Nacht in der Kirche gewesen. Ihr seht ja alle ganz verorgelt aus. Die ganze Nacht wohl zentnerschwere Weiber gestemmt? Passt bloß auf, dass euch die Dorfjungs nicht zu fassen kriegen, die schneiden euch glatt die Eier ab.“
Nun, die Dorfjungen haben uns nicht zu fassen bekommen, aber nach über einer Woche kam der Tag, vor dem wir uns so gefürchtet hatten. Wir saßen ein letztes Mal auf der Treppe unserer Kapelle und die Tränen flossen fürchterlich. Peggi weinte an meiner Brust und auch mir war danach zumute. Am härtesten traf es die Freundin des Leichtmatrosen. Sie konnte sich überhaupt nicht beruhigen und wollte mit ihm an Bord durchbrennen. Auch ihn, den harten Fallschirmjäger, musste es hart erwischt haben, denn sie saßen beide da, wie zwei Häufchen Elend. Wir tauschten unsere Adressen aus, schworen uns ewige Treue und schlichen im Morgengrauen mit sehr gebrochenen Herzen an Bord. Wir hofften, dass wir diesen Liegeplatz bald wieder ansteuern würden, aber wie die Mädchen schon gesagt hatten, verirrte sich nur alle paar Jahre ein Schiff dorthin, und ich habe meine Peggi nie wiedergesehen. Auch unser Briefwechsel wurde mit der Zeit immer spärlicher. Nur unser Leichtmatrose bekam von seiner Liebsten lange Zeit treue Briefe. Aber das Leben ging weiter.
Beförderung zum Jungmann
Nach ein paar Reisen musterte unser Matrose ab, da er rechtzeitig zu seinem Prozess in Hamburg sein musste, und ich wurde zum Jungmann befördert. Wir fuhren wieder unterbesetzt, und eines Tages ging auch der Leichtmatrose von Bord. Vielleicht ist er zu seiner Mauren nach Irland gegangen, wie er es vorhatte, denn seitdem habe ich ihn nie wieder gesehen oder je etwas von ihm gehört. Wir bekamen zwei neue Mosese als Ersatz, so dass wir nun mit drei Schiffsjungen und mir als Jungmann fuhren. Ich war jetzt der Rangälteste unter der Back und machte praktisch die Arbeit eines Matrosen. Meine Heuer hatte sich, mit Überstunden, auf ca. 90 Mark erhöht, und ich konnte mir zum erstenmal ein paar Klamotten kaufen. Die beiden neuen Schiffsjungen waren 19 Jahre alt, also zwei Jahre älter als ich, hatten beide das Abitur und kamen von der neuen Schiffsjungenschule auf dem Priwall bei Travemünde. Beide stammten aus guten, begüterten Häusern, und ihre Eltern waren irgendwie mit dem Eigner bekannt. Sie sollten hier nur die Zeit überbrücken, bis bei der großen Reederei Hapag zwei Stellen frei sein würden, was auch ihrem Niveau mehr entsprach. Wir nannten sie nur die „Abis“.
Die Herkunft der beiden beeindruckte unseren Alten und den Steuermann jedoch keineswegs, denn diese hatten zu ihrer wahren Persönlichkeitsstruktur zurückgefunden und zeigten wieder ihr altes Gesicht. Die altbekannten Sprüche lebten wieder auf und wurden zum alltäglichen Wortschatz: „Wichskopf, dumme Sau, ich trete dir in den Arsch“ oder „ich reiß dir gleich den Hintern auf.“ Natürlich wurde auch sonntags wieder im „Schiffsinteresse“ gearbeitet bzw. zugetörnt. Aber in den beiden Abis hatten sie Meister der Anpassung gefunden, die sich drückten, wo sie nur konnten und grundsätzlich nur mit „halber Kraft“ nach dem physikalischen Prinzip arbeiteten: „Durch wenig Arbeit möglichst viel Nutzen erzielen.“ Wenn sie dann auch noch versuchten, den Steuermann mit akademischen Fremdwörtern zu überzeugen, wurde der ganz wild und wenn wir dann lachen mussten, warf er mit den Lukenkeilen nach uns.
Wir machten drei Reisen von Antwerpen mit Kupferschrott nach Rostock und so lernte ich 1953 auch das andere Deutschland kennen. Überall im Hafen standen seit dem 17. Juni bewaffnete Posten, und unser Schiff wurde von oben bis unten gründlich durchsucht. Wir bekamen Landgangsausweise, die uns erlaubten, bis 23.30 Uhr an Land zu bleiben. Kam jemand zu spät zurück, wurde ihm der Landgangsschein entzogen. Alles Geld musste deklariert und bei der Ausreise wieder vorgezeigt werden. Man konnte auch seine West-Mark offiziell eins zu eins umtauschen oder bei der Staatsagentur Ostmark aufnehmen. Natürlich machte das niemand, denn der Schwarzmarktkurs stand eins zu fünf.
Der Kupferschrott bestand aus großen zerlegten Kesselstücken, die einzeln mit unseren Ladebäumen an Land gehievt und dort von zwei Mädchen gezählt und in ihr Tallybuch eingetragen wurden. Auch das Schiff musste zwei Tallyleute stellen, und so kamen wir mit den beiden jungen Damen näher in Kontakt. Die eine, die es auf mich abgesehen hatte, hieß Helga, war ca. 20 Jahre alt, dunkelhaarig, schlank mit hübschem Gesicht und einem klassischen „Silberblick“. Die andere, an die sich einer unserer Abis hielt, war auch nicht älter, aber blond und etwas runder. Beide Mädchen waren nicht prüde und so verabredeten wir uns für den Abend an Land in einer Kaschemme, die „Tante Mayer“ hieß. Das Löschen ging sehr langsam vonstatten, da es sehr schwierig war, im Laderaum Drahtschlingen (Stroppen) an den einzelnen Kupferstücken anzubringen, mit denen man sie an Land hieven konnte. Jedes einzelne Stück musste zudem noch an Land gewogen werden. Außerdem wurde uns angedeutet, dass es zeitweilig zu Problemen mit der Transportkapazität kommen und sich dadurch das Löschen verzögern könne. Dies alles ließ auf eine lange Hafenliegezeit schließen.
Der andere Abi hatte inzwischen den Lokführer und Heizer einer Rangierlok kennen gelernt, die mit ihrem Schienenfahrzeug einigermaßen unkontrolliert die Hafenbegrenzung passieren konnten. Sie wollten uns für eine Stange „Chesterfield“, die wir an Bord zollfrei für 5,- DM bekamen, 100 Ostmark zahlen. Das Geld sollte für uns bei „Tante Mayer“ hinterlegt werden. Dort sollten wir uns an den Kellner Erich wenden. Klar, dass wir auf dieses Geschäft eingingen. Da wir gehört hatten, dass es an Land in der Stadt mit der Straßenbeleuchtung sehr schlecht bestellt war und es weithin dunkel bleiben würde, steckten wir uns jeder eine Taschenlampe ein. Davon hatten wir einige Hundert Stück mit Batterien an Bord. Davon waren mal einige Kartons aus einer Ladung beim Löschen zurückgeblieben. Mit zwei Schachteln Zigaretten in der Tasche und ausreichender Beleuchtung ausgerüstet, machten wir uns wohlgemut auf den Weg zu unserem Treffpunkt.
Am Hafentor mussten wir bei den Vopos (Volkspolizei) unsere Seefahrtbücher abgeben und bekamen dafür die Landgangsscheine. Wir wurden noch gründlich nach Geld gefilzt und mussten dazu auch unsere Schuhe ausziehen. Die Durchsuchung fand in der Wachbude statt und man ließ bei der Leibesvisitation keine Stelle am Körper aus. Der eine Abi fragte eine der dort in schicker blauer Uniform sitzenden weiblichen Beamtinnen, ob sie ihn nicht einmal untersuchen könne, aber da wurden die alle sehr böse und warfen uns raus. An Land sah es furchtbar ärmlich und ungepflegt aus. Die Straßen hatten große Löcher und man musste im Dunkeln aufpassen, dass man darin nicht stolperte. Unsere Taschenlampen erwiesen sich also als sehr nützlich. Man begegnete in Hafennähe kaum Menschen und nur die laute Musik aus der Ferne zeigte uns die Richtung zu unserem Treffpunkt an.
Bei „Tante Mayer“ war wirklich etwas los. Seeleute aus aller Herren Länder trafen sich hier, dazu eine Menge schräger Damen, aber auch Hafenarbeiter, Normalbürger und Schwarzhändler. Es wurde fürchterlich gesoffen, gegrölt und gekreischt. Dazu spielte ein Schifferklavier die neuesten Ohrwürmer, Oldies und Seemannslieder. Die Tanzfläche war propenvoll, und jeder schob dort ein weibliches Wesen vor sich her. Es war, als ob die Menschheit außer Rand und Band geraten wäre. In der Nähe der Tür saß eine ältere Frau, offenbar „Tante Mayer“ persönlich, auf einem Stuhl und begrüßte jeden Gast. Wir drängten uns durch die Menge und fanden unsere „Tallygirls“ an einem abseits stehenden Tisch am Ende des Raumes. Sie saßen alleine und hatten schon auf uns gewartet. Beide waren ordentlich flott zurechtgemacht. Obwohl ich damals gerade erst 17 Lenze zählte, fühlte ich mich der bevorstehenden Aufgabe durchaus gewachsen. Da wir ja kein Geld hatten, fragte ich sie nach Erich, und Helga holte einen breitschultrigen älteren Mann in Kellnerjacke an den Tisch. Erich war schon genau informiert. Er hatte schütteres Haar, wieselflinke Augen und den „ostdeutschen Blick“. Schon im Hafen war mir dieser Blick bei einigen Leuten aufgefallen, denn bevor sie mit einem sprachen, schauten sie erst mal über ihre Schulter, ob auch niemand zuhörte. Erich wusste also schon Bescheid. Wir sollten erst mal bestellen. Später beim Bezahlen würde er dann mit uns abrechnen.
Wir bestellten großzügig, denn ein Glas Bier kostete nur 50 Ostpfennig und ein Schnaps kaum mehr. Bei diesen Preisen hätten unsere 100 Mark für eine Woche Sauforgie ausgereicht. Am meisten tranken die skandinavischen Seeleute, von denen bereits viele volltrunken waren. Unsere Tischdamen erzählten uns, dass viele dieser Skandinavier, wenn sie mit einem Mädchen „nach Hause“ gehen, am nächsten Tag ohne Uhr und Klamotten aufwachen würden. Die Polizei müsse sie dann, in eine Decke gehüllt, an Bord bringen. Da es an Land kaum etwas Brauchbares zu kaufen gab und außer Alkohol fast alles Mangelware war, wurden hier im Lokal viele Dinge unter der Hand verkauft. Ständig wollte uns jemand unsere Armbanduhren oder die Taschenlampen abkaufen. Wir vier an unserem Tisch wurden immer lustiger, und ab und zu schoben wir auch eine heiße Platte auf der improvisierten Tanzfläche. Tanzen konnte man das eigentlich gar nicht nennen, es war mehr ein Geschiebe und Gedränge und man musste höllisch auf seine Füße aufpassen. Je später es wurde, um so nervöser wurden unsere Damen. Ab und zu ging eine vom Tisch fort und kam dann gleich wieder zurück. Inzwischen waren wir uns alle sehr nahe gekommen, und wir drängten zum Aufbruch, denn um 23.30 Uhr mussten wir ja wieder am Tor sein.
Unsere Damen sagten, dass sie erst mal alleine hinausgehen würden, damit man uns nicht zusammen sehen könne. Wir sollten noch zehn Minuten sitzen bleiben und dann folgen. Sie würden draußen auf uns warten. Wir bestellten noch einmal ein Getränk und rechneten mit Erich ab. Nach zehn Minuten verließen auch wir das Lokal, wo es immer noch hoch her ging. Draußen war es stockdunkel und wir mussten unsere Augen erst an die Finsternis gewöhnen, bis wir in etwa 20 Metern neben einer trüben Straßenfunzel unsere Tallygirls sahen. Der Abi und ich liefen sofort hin und als wir uns alle gemeinsam untergehakt hatten, tauchten wie aus dem Nichts zwei riesige uniformierte Gestalten auf. Beide Mädchen schrieen entsetzt auf und Helga versuchte, dem einen, den sie Klaus nannte, zu erklären, dass sie uns nur zum Tor bringen wollten, da wir nicht wüssten, wo es lang geht. Aber einer der Hünen in Grenzeruniform wurde furchtbar wütend. Er wollte auf uns losgehen und Helga warf sich ihm in den Weg. Den anderen nicht minder zornigen Riesen umklammerte das andere Mädchen, so dass es ein wildes Gerangel gab. Schließlich beruhigten sie sich etwas, aber der Klaus schrie laut: „Seht zu, dass ihr schleunigst an Bord kommt, ihr Strolche, oder ich mach euch Beine. Ihr denkt wohl, weil ihr aus dem Westen kommt, könnt ihr Kapitalistenschweine euch alles erlauben.“
Aber an Bord zu gehen, hatten wir noch keine Lust. Darum schlugen wir den Weg zurück zu „Tante Mayer“ ein. Das passte dem Riesen gar nicht, denn er schrie: „Ich hab gesagt, ihr sollt an Bord gehen! Los in die andere Richtung oder es setzt was!“ Da wurde auch ich wütend. Alkohol suggeriert Stärke. Ich schrie, während ich ihm mit der Taschenlampe ins Gesicht leuchtete: „Du Affengesicht hast uns überhaupt nichts zu sagen. Wir gehen, wohin wir wollen.“ Das hätte ich nicht tun dürfen, denn mit lautem Geschrei tobten die beiden auf uns los, und wir liefen um unser Leben. Wir waren gerade noch an „Tante Mayer“ vorbei ins Lokal gestürzt, als die zwei Hünen uns zu fassen bekamen und auf uns einschlugen. Man sagt, dass Intelligenz eine stärkere Waffe sei, als brutale Gewalt und ich glaube, dass die Geistesgegenwart des Abi diese Weisheit bestätigte und uns vor einer furchtbaren Tracht Prügel rettete. Er schrie nämlich laut: „Hilfe, wir kommen aus dem Westen und die zwei wollen uns unsere Uhren abnehmen.“
Zwei Sachen hatten die Ostdeutschen den Russen damals noch nicht vergessen, dass die Sowjets bei ihrem Sieg 1945 fast alle Frauen vergewaltigt und den Leuten sämtliche Uhren abgenommen hatten. Nach diesem Hilfeschrei herrschte einen Moment atemlose Stille, dann aber sprangen etwa 30 Kerls von ihren Stühlen auf, und es setzte Hiebe für die beiden Uniformierten. Ein Kellner und die alte „Tante Mayer“ warfen sich dazwischen und nur mit viel Mühe und ziemlich ramponiert gelang es unseren Angreifern, durch die Tür nach draußen zu entkommen. Im Lokal herrschte große Aufregung und einer schrie: „Die Schweine fangen jetzt auch schon an, Uhren zu klauen wie die Russen.“ Gott sei Dank hatte ich mir vor unserem Aufbruch von Bord tatsächlich meine Konfirmationsarmbanduhr umgebunden und auch der Abi trug seine „Omega“ am Handgelenk. Bis auf kleine Blessuren waren wir beide bei der Keilerei noch einmal ganz gut weggekommen. Wir mussten uns zu einigen Leuten an den Tisch setzen und bekamen tüchtig eingeschenkt, so dass es uns bald wieder gut ging. Auch wir gaben für unsere Retter eine Runde aus und bekamen wiederum einen ausgegeben und bald verlor ich den Überblick. In einem lichten Moment sah ich unseren Abi mit einer schwarzhaarigen Holden im Clinch, die Kranführerin einer Hafenbrigade war und ihn anhimmelte. Er sah ja mit seinen blauen Augen recht gut aus, und man könnte ihn heute für einen „Terence-Hill-Verschnitt“ gehalten haben. Ich selbst hatte schon schwer einen im Zacken und wollte eben schon stark frustriert gehen, als mich der Abi fragte: „Mensch Seemann, was soll ich morgen bloß dem Alten sagen, wenn ich zu spät an Bord komme?“ „Ganz einfach“, antwortete ich ihm, „sag, du hast dich in dieser großen dunklen Stadt furchtbar verlaufen. Als du so umherirrtest, hast du in deiner Verzweiflung an irgendeiner Tür geläutet. Die Leute hätten aufgemacht und dir ein Bett zum Schlafen angeboten und dann vergessen, dich morgens rechtzeitig zu wecken. Damit kommst du immer durch.“
Als die einheimischen Gäste das von der großen dunklen Stadt hörten, brachen sie in ein schallendes Gelächter aus, und ich musste noch einen mittrinken, ehe ich endlich an die frische Luft kam. Meinen Landgangsschein hatte ich ohnehin verwirkt und mit schwerer Schlagseite tastete ich mich mit meiner Taschenlampe vorwärts.
Irgendwie erreichte ich eine Kaschemme, die „Kogge“ hieß und wo noch was los zu sein schien. Inzwischen war ich schon etwas nüchterner geworden und auch mein Gang wieder etwas sicherer. Als ich eintrat, bemerkte ich einige Gäste, von denen die meisten an der Theke standen. Es war schon kurz vor Mitternacht, und die Gäste am Tresen hatten ganz schön einen in der Krone. Es war nur ein Tisch besetzt, an dem zwei Männer und eine Frau vor einer großen Flasche Wodka saßen.
Um diese Zeit war ich der einzige „Westler“ im Lokal und es dauerte nicht lange, bis ich mit den Leuten ins Gespräch kam. Da die meisten von ihnen morgens wieder arbeiten mussten, blieben mit der Zeit nur noch einige Fischdampferleute mit ihren Mädchen und die drei Gäste hinter der Wodkaflasche am Tisch übrig. Wir unterhielten uns prächtig und da ich mit dem Rest meines Ostgeldes wegen des ohnehin verwirkten Landgangsscheines nichts mehr anfangen konnte, schmiss ich eine Lokalrunde nach der anderen. Die Kellnerin, eine schon ältere Frau mit einem gesunden Mundwerk, schimpfte fürchterlich über die schlechte Straßenbeleuchtung auf ihrem Heimweg und dass sie beinahe einmal in der Nähe ihres Hauses in eine Baugrube gefallen sei. Ich gab ihr Recht, schenkte ihr in einem Anfall von Großmut meine Taschenlampe und hatte damit gleich ihr Herz erobert. Dann sangen wir alle zusammen das Lied vom Hamburger Veermaster sowie weitere Seemannsshanties, und einer der Fischdampferleute holte seine Mundharmonika aus der Tasche und begleitete unseren Gesang. Wir klatschten nach jedem Lied, und auch die drei Wodka-Gäste klatschten begeistert mit.
Gerade als ich mir Gedanken zu machen begann, wie ich wieder an Bord käme, kam die Kellnerin und sagte mir, dass die „drei Russen“ am Tisch mich näher kennen lernen wollten. „Sei vorsichtig, Junge“, raunte sie mir zu, „man kann nie wissen, was die vorhaben.“ Ich weiß bis heute nicht, wer die drei Russen waren, aber der hagere von ihnen bedankte sich in perfektem Deutsch bei mir für die Getränke und bat mich, bei ihnen Platz zu nehmen. Die Kellnerin brachte ein großes Glas und ich bekam einen tüchtigen Schuss Wodka aus der Flasche eingeschenkt. Die Frau war etwa vierzig Jahre alt, hatte schwarzes Haar, dunkle Augen und harte sibirisch-asiatische Gesichtszüge. Irgendwie gefiel sie mir. Der andere Mann war breitschultrig, untersetzt und wohl die Autoritätsperson unter den dreien. Alle waren in Zivil und nur der Hagere sprach deutsch. Beide Männer waren Anfang fünfzig. Der Hagere fragte mich, ob ich aus dem „Westen“ käme, wie alt ich sei und ob ich immer so großzügig Runden ausgebe. Er übersetzte den beiden meine Antwort, dass ich fast 18 und Seemann auf einem westdeutschen Kümo und zum ersten Mal in Rostock sei, auch dass Seeleute sich überall in der Welt verstehen würden und dass derjenige, der gerade mehr Geld in der Tasche habe, als die anderen, auch eben großzügiger sein müsse.
Der Untersetzte ließ fragen, ob auch russische Seeleute so großzügig seien und ich antwortete ihm, dass ich glaube, dass kein russischer Seemann seine Flasche Wodka alleine austrinken würde, wenn zwei Seeleute neben ihm säßen, egal wo sie herkämen. Das gefiel ihm so sehr, dass er noch eine Flasche bestellte. Die Frau ließ mich fragten, wann ich denn Kapitän werden würde und ich erklärte ihr, dass es bis dahin noch ein sehr langer Weg sei. Sie fragten mich nach meinen Eltern und als ich ihnen erzählte, dass ich Vollwaise sei, bemerkte der Untersetzte, dass der Krieg viele Waisen hervorgebracht habe und auch in der Sowjetunion viele Kinder ihre Eltern verloren hätten. Es wurde an unserem Tisch immer geselliger und nach der nächsten Flasche hörte ich auch zum ersten Mal russische Witze, über die ich sehr lachen musste. Unterdessen waren wir nur noch die einzigen Gäste im Lokal, und auch der Wirt und die Kellnerin hatten sich zu uns an den Tisch gesetzt.
Irgendwann kam auch ich an die Reihe, einen typischen Seemannswitz zu erzählen. Ich hatte zum erstenmal in meinem Leben so viel Alkohol getrunken, und so fiel mir nur der Witz von dem Seemann ein, der das erste Mal in Amerika war. Dieser Witz war nicht ganz anständig, aber ich erzählte ihn trotzdem: Ein Seemann läuft mit seinem Schiff nach einer langen Seereise in New York ein. Er ist das erste Mal in Amerika und hatte sich vor dem Landgang einen angetrunken. Wie er so durch die Straßen schaukelt, sieht er überall Automaten stehen, für Coca-Cola, für Zigaretten, für Strümpfe ect. Da er so etwas noch nie vorher gesehen hatte, probiert er einen aus. Er wirft 25 Cent in den Coca-Cola-Automaten und sofort kommt aus einem großen Schlitz eine Flasche Cola heraus. Mann, das ist ja eine feine Sache, denkt er und wirft auch in einen Zigarettenautomat Geld hinein und prompt kommt eine Schachtel Zigaretten heraus. Wie er so weiter durch die Straßen schlingert und all die hübschen Mädchen sieht, wird ihm nach der langen Seereise ganz anders. Plötzlich sieht er an einer Ecke einen einsamen Automaten mit einem Loch in der Mitte stehen auf dem steht: „Ersetzt die Ehefrau.“ Der Seemann dreht sich um und schaut, ob jemand in der Nähe ist und da niemand zu sehen ist, holt er seinen Penis heraus und steckt ihn in das Loch. Plötzlich ertönt auf der Straße ein furchtbarer Schrei und als die Leute hinzulaufen, sehen sie auf dem Penis des Seemannes einen angenähten Knopf. - Der ganze Tisch brüllte vor Lachen und auch der Wirt und die Kellnerin, die hartes Publikum gewöhnt waren, hatten diesen Witz noch nicht gehört und lachten herzlich mit.
Es war unterdessen schon weit nach ein Uhr, ich dachte mit Schrecken daran, wie ich wohl an Bord kommen sollte und teilte dies den anderen mit. Die Russen meinten, ich solle mir mal keine Sorgen machen, das würden sie schon in Ordnung bringen und mich an Bord fahren. Als wir aufbrachen, fuhr ein großer Wagen mit einem Fahrer in Militäruniform vor die Tür und nachdem wir eingestiegen waren, ging es in Richtung Hafen. Am Tor angekommen, verschwand der Hagere in der Wachbude und kam gleich mit meinem Seefahrtbuch zurück. Der Posten am Tor und auch der Wachführer salutierten militärisch, und unser Fahrer brachte mich direkt vor mein Schiff. Wir verabschiedeten uns herzlich und die Frau wünschte mir, dass ich bald Kapitän werden und wir uns alle einmal wiedersehen würden. Ich weiß bis heute nicht, wer und was sie waren und habe sie auch nie wiedergesehen.
Um 7 Uhr früh standen wir wieder auf der Matte und wenn mein schwerer Kopf nicht gewesen wäre, hätte ich mich ausgezeichnet gefühlt. Der zweite Abi war noch nicht an Bord zurück und der Alte fragte mich, wo der „Wichskopf“ geblieben sei. Als ich ihm erzählte, dass wir uns getrennt hätten und er sich wohl verlaufen habe, wurde er ganz wild und ich sah zu, dass ich aus seiner Nähe kam. Unsere Tallygirls machten einen sehr niedergeschlagenen Eindruck, und Helga hatte eine geschwollene Lippe. Wahrscheinlich hatte ihr Freund Klaus die im Lokal bezogene Prügel an sie weitergegeben. Der Vorfall vom Abend zuvor wurde peinlichst übergangen. Ich schenkte beiden eine neue Taschenlampe mit ausreichend Batterien, ihre Mienen hellten sich auf und man sprach wieder miteinander. Gegen Mittag kam unser zweiter Abi mit weichen Knien von Land zurück und nachdem ihn der Steuermann und der Alte kräftig zur Sau gemacht hatten, war alles wieder im Lot. Obwohl ich meinen Landgangsschein behalten hatte, ging ich bis zum Auslaufen nicht wieder in die Stadt, und so blieb es bei diesem einen Ausflug in den „ersten deutschen Arbeiter- und Bauernstaat“.
Ich habe von der großen Anzahl der Häfen, die wir in den 17 Monaten Fahrzeit auf der „Rügen“ anliefen, nur wenige erwähnt. Es würde den Rahmen dieses Buches sprengen, sie alle aufzuführen. Wann immer wir in einem Hafen die Gelegenheit hatten, der düsteren Enge unserer Unterkunft an Bord zu entfliehen, nahmen wir sie wahr. Und wohin konnte der Seemann denn schon nach Feierabend gehen? Doch nur dorthin, wo sich auch andere Seeleute trafen. So endete der Landgang bei vielen in irgendeiner Hafenkneipe. Ich will nicht behaupten, dass wir nur in solchen Kaschemmen verkehrten. Das konnten gerade wir Junggrade uns schon alleine finanziell nicht leisten. An Land musste für alles bezahlt werden, denn umsonst gab es nirgendwo etwas. So blieb es meistens nur bei sporadischen Besuchen bei einem Glas Bier und man trollte dann wieder an Bord zurück. Oft ging ich ins Kino, auch wenn ich im Ausland die Sprache nicht verstand, Hauptsache, die Bilder bewegten sich. Wenn wir im dunklen kalten Winter abends im Hafen alle auf engem Raum zusammengepfercht saßen, war das eine deprimierende Zeit, und nicht selten entluden sich aufgestaute Aggressionen, die in Gewalt ausarteten. Man brauchte nur eine unglückliche Bemerkung zu machen und schon war man schnell in eine Schlägerei verwickelt, die nicht selten tragisch endete, zumal, wenn noch Alkohol mit im Spiel war.
Wir fuhren noch eine ganze Zeit mit nur vier Junggraden und dies muss für den Alten und Steuermann die schönste Zeit gewesen sein. Sie scheuchten uns, wann immer sie wollten, und keiner von uns wagte sich dagegen aufzulehnen. Wir waren eben nur Junggrade und es nicht anders gewohnt. Nur unsere zwei Abis zeigten ihnen manchmal ihre geistige Überlegenheit durch besondere Fremdwörter und Begriffe, worauf der Alte und Steuermann mit Wutausbrüchen reagierten. Ob Sonn- oder Feiertag, gearbeitet wurde immer, und keiner von uns Junggraden wäre auf den Gedanken gekommen, die Arbeit zu verweigern, auch wenn sie meistens wegen „Schiffsinteresses“ deklariert unbezahlt geleistet werden musste. Irgendwann war es den Behörden wieder aufgefallen, dass wir ohne Vollgrad fuhren, und der Alte musste notgedrungen einen Matrosen einstellen. Der Neue war ein großer, sehniger Mann mit ungemein kräftigen Händen und breiten Schultern. Seinen Namen weiß ich nicht mehr, aber er sollte für uns alle von schicksalhafter Bedeutung werden. Er war etwa 35 Jahre alt, dunkelhaarig, braungebrannt, schweigsam und kam aus der Fischerei. Beim Alten und Steuermann stieß er allein wegen der Tatsache, dass er Matrose war, auf strikte Ablehnung, und sie ließen es ihn sooft wie möglich spüren.
Wie bereits erwähnt, waren die Vollgrade nur Lückenbüßer im äußersten Notfall, um der Schiffsbesetzungsordnung Genüge zu tun, und die meisten Matrosen wurden nach kurzer Zeit wieder von Bord geekelt. Unser Matrose war ungemein stark und wenn wir mit zwei Mann unter großer Mühe eine zusammengerollte Persenning auf die Luke wuchteten, machte er dies spielend alleine. Für uns Junggrade war er die ideale Respektsperson. Er trank und fluchte nicht und hatte uns unter Zug. Auch sorgte er vorne für Ordnung und Sauberkeit und duldete es nicht, wenn wir aus Faulheit mit schmutziger Wäsche und fleckiger Kleidung herumliefen. Zu uns war er immer fair und kameradschaftlich. Gleichzeitig sorgte er dafür, dass die gesetzlichen Arbeitszeiten eingehalten und Überstunden bezahlt wurden, es sei denn, es lagen wirklich triftige Gründe vor, die um die Schiffssicherheit befürchten ließen. Er setzte sich auch dafür ein, dass Peter, der nun schon über ein Jahr an Bord war, zum Jungmann befördert wurde, wie es gesetzlich vorgeschrieben war. So viel soziales Engagement konnte natürlich auf die Dauer nicht gut gehen. Für uns Junggrade war er so etwas wie eine Vaterfigur, und wir respektierten und bewunderten ihn.
Wir lagen wieder einmal in Hamburg, unserem Heimathafen, und warteten auf Ladung. Tagsüber malten wir den Laderaum und abends konnten wir, ausgenommen die Bordwache, an Land gehen oder je nach Laune an Bord ausschlafen. Der Eigner ließ sich einige Male sehen und der Alte und der Steuermann gingen schon am frühen Nachmittag zu ihren Familien, so dass auch für uns, wenn sie verschwunden waren, der Feierabend anbrach. An einem Samstag am späten Abend, wir hatten uns schon auf den freien Sonntag gefreut, kam unser Steuermann unerwartet ziemlich übellaunig an Bord zurück. Er eröffnete uns in barschem Ton, dass wir am Sonntagmorgen zutörnen müssten. Wir waren natürlich alle recht sauer und nahmen an, dass bei ihm zu Hause der Haussegen schief hing und er deshalb an Bord zurückgekommen war, um seine Aggressionen an uns auszulassen. Wahrscheinlich hatte ihn seine Frau zu Hause rausgeschmissen. Unser Matrose, der schon vorher an Land gegangen war und von dieser Entwicklung nichts wusste, muss sehr spät zurückgekommen sein, so dass ihn keiner von uns über den neuesten Stand der Dinge unterrichten konnte, da wir alle bereits schliefen.
Aus irgendeinem Grund überhörten wir alle die Alarmklingel, mit der wir normalerweise morgens geweckt wurden, denn plötzlich stand unser Steuermann in unserem Logis und brüllte uns furchtbar an. Er riss die Kojenvorhänge zurück, rüttelte jeden an der Schulter und schrie dabei etwas von faulen Schweinen. Als er auch den Matrosen an der Schulter rüttelte, sprang dieser aus der Koje heraus und verpasste dem Steuermann zwei so gewaltige Maulschellen, dass dieser gegen die Wand geschleudert wurde. Der sagte keinen Ton und verschwand, so schnell er konnte aus dem Logis. Wir standen wie erstarrt da und der Matrose sagte: „Kein Mensch fasst mich ungestraft an und nennt mich „faules Schwein“, auch kein Steuermann.“ Dann packte er seine Sachen. Es war niemand unter uns, der dem Steuermann dies nicht gegönnt hätte. Zu lange hatte er uns drangsaliert, und wir waren uns einig, dass wir gesehen hätten, dass der Steuermann zuerst geschlagen hatte.
Am Montag Morgen mussten wir Junggrade alle einzeln beim Eigner im Salon des Alten erscheinen, um in Gegenwart des Steuermanns und des Alten auszusagen. Wir blieben dabei, dass der Steuermann zuerst geschlagen habe, und auch Drohungen mit Seeamt und Entzug des Seefahrtbuches konnten unsere Aussage nicht erschüttern. Zähneknirschend mussten sie dem Matrosen eine Monatsheuer extra zahlen, bevor er auf eigenen Wunsch abmusterte. Der Steuermann, der mit grün und blau gefärbtem Gesicht dabeistand, schaute uns hasserfüllt an und wir beschlossen, alle gemeinsam zu kündigen. Das war natürlich nicht im Sinne des Eigners, und er versuchte, uns mit allen Mitteln zu überreden, an Bord zu bleiben. Aber zu tief saß uns unsere Angst vor dem Steuermann im Nacken. Der Groll gegen ihn und den Alten bestärkten uns, bei unserer Kündigung zu bleiben. Auch die beiden Abis, deren Eltern mit dem Eigner bekannt waren, blieben hart. Nachdem unsere Kündigungsfrist von 48 Stunden abgelaufen und die neue Besatzung an Bord war, verließ ich mit einem mir bisher unbekannten Gefühl der Erleichterung das Schiff. Ich quartierte mich wieder beim Seemannsheim in der Großen Elbstraße ein, in dem ich bereits vor 18 Monaten als unbefahrener Schiffsjunge gewohnt hatte. Mein Restguthaben plus Urlaubsgeld betrug nach über 17 Monaten Fahrzeit an Bord des Kümos „Rügen“ 135 DM.
Ich hielt mich vier Wochen im Seemannsheim auf und musste jeden Wochentag morgens auf dem „Stall“ erscheinen. „Stall“ wurde die Heuerstelle genannt, die in einem Keller am Baumwall untergebracht war. Dort hingen jeden Tag einige Hundert Seeleute herum, die ein Schiff zu bekommen hofften. Wenn der Heuerbaas die Klappe zu seinem Büro hochriss und z.B. schrie: „Ein Matrose, Große Fahrt!“, stürzten die wartenden Matrosen hin und gaben ihre Seefahrtbücher ab. Manchmal stapelte sich dann ein riesiger Berg von Seefahrtbüchern vor dem Baas. Nach einiger Zeit, wenn der die Bücher durchgesehen hatte, ging die Klappe hoch und der ausgewählte Matrose musste durch eine besondere Tür ins Büro treten und bekam dort als Lohn für oft langes Warten seinen Heuerschein ausgehändigt. Man munkelte, dass besonders begehrte ausländische Schiffe, etwa Norweger, Schweden oder Dänen mit extrem guter Bezahlung und guten Arbeitsbedingungen, „unter der Hand“ vermittelt wurden. Aber das waren nur Vermutungen, die nie bewiesen werden konnten. Der Heuerbaas wurde damals allgemein Jonny genannt. Er war ein richtiges Original, hieß mit Familiennamen Backhusen, und es waren die unmöglichsten Gerüchte über ihn im Umlauf.
Jungmann auf dem Dampfer „HOHEWEG“
Was damals vor allem zählte, waren gute Fahrzeiten im Seefahrtbuch, und so dauerte es gar nicht lange, bis ich als Jungmann ein neues Schiff bekam: Die „HOHEWEG“ war ein alter Dampffrachter, dessen Kessel noch mit Kohlefeuerung betrieben wurden. Er gehörte der Reederei Schuchmann in Hamburg und war 1905 gebaut worden. Weil das Schiff zu alt war, wurde es 1945 nicht als Kriegsbeute von den Engländern beschlagnahmt und war damit eines der ersten Schiffe der deutschen Nachkriegshandelsflotte.
Die „HOHEWEG“ hatte eine Kapazität von 1.750 TDW und lief bei glatter See etwa acht Knoten. Sie war in der Nord- und Ostseefahrt eingesetzt. Während des Krieges soll sie durch eine Mine gesunken und nach der Bergung wieder in Dienst gestellt worden sein. Als ich am Schuppen 22 an Bord ging, kam sie mir mit ihren Mittschiffsaufbauten und dem hohen Schornstein, im Gegensatz zu meinem ersten Kümo, gewaltig vor. Auch hier waren die Mannschaftsunterkünfte vorne unter der Back, aber größer und geräumiger. Auf der Backbordseite wohnte die Deckscrew, steuerbordseits die Heizer, und dort befand sich auch die gemeinsame Mannschaftsmesse.
Die Deckscrew bestand aus fünf Matrosen und zwei Junggraden. Die Matrosen waren alle ältere ruhige Männer mit langjähriger Erfahrung, die ihre Arbeit verstanden. Drei der Matrosen sind mir noch gut in Erinnerung. Einer hieß Helmuth, war Mitte dreißig und früher Berufstaucher gewesen. Er erzählte mir, er habe nach dem Krieg die Leichen ertrunkener KZ-Häftlinge aus einem versenkten Schiffswrack bergen müssen, eine furchtbare Arbeit, die er nie im Leben vergessen werde. Die SS hatte kurz vor Kriegsende Häftlinge auf einen KDF-Dampfer gepfercht, und das Schiff war dann von den Engländern in der Lübecker Bucht irrtümlich versenkt worden. Der andere, älteste Matrose, mein Namensvetter, hieß wie ich Emil, war über 50 Jahre alt und ein merkwürdiger Mensch. Er sprach nie über sich selbst und trank nur ab und zu einen über den Durst. Dann war er für die Reize der Damenhalbwelt sehr aufgeschlossen und holte sich meistens eine Nutte an Bord. Da wir in unserem Massenlogis nachts ja alles mitbekamen, musste er sich von uns manchmal für seine „Leistungen“ entsprechende Kritik anhören. An den anderen Junggrad, der wie ich Jungmann war, kann ich mich nicht mehr so gut erinnern. Er war ein schlanker schweigsamer Bursche, mit dem ich nicht warm wurde. Er blieb nicht lange an Bord. Unser „Schlüsselmatrose“ (Bootsmann) war schon über 15 Jahre bei der Reederei, ca. 42 Jahre alt und kräftig gebaut. Seine Anordnungen wurden ohne Widerrede befolgt.
Von der Maschinencrew kann ich mich besonders an den Donkeymann (Oberheizer - Pendant zum Bootsmann) Franz und die Heizer Stephan und Paul erinnern. Franz war ein breitschultriger, kräftiger Mann, schon über 60 Jahre alt und ca. 1,95 m groß. Er war grundsolide, sehr religiös und hatte beide Kriege als Heizer auf Kriegsschiffen mitgemacht. Franz wohnte in Kiel und die „Hoheweg“ war sein letztes Schiff vor der Pensionierung. Heizer Paul kam aus dem Milieu. Er war am ganzen Körper tätowiert und über 40 Jahre alt. Auf der linken Wange hatte er eine große Messernarbe, die ihm ein gefährliches Aussehen gab. Er war athletisch gebaut, stark wie ein Stier und ein gefährlicher Schläger. Auf der „Meile“ und in der Unterwelt hieß er nur „Jack the Ripper“ (Prachtkerl) und wenn er einmal in Wut geriet, konnte ihn nichts aufhalten. Wurde er einmal in einer Kaschemme in eine Schlägerei verwickelt, verwandelte er sich in eine gefährliche Kampfmaschine, die keiner stoppen konnte.
Ich habe einmal selbst erlebt, wie er es in einer Kneipe mit acht Mann auf einmal aufnahm und sie krankenhausreif schlug. Sie droschen mit Flaschen und Stühlen auf ihn ein, aber dies steigerte nur noch seine Wut und als er ein Tischbein zu fassen kriegte, schlug er damit solange um sich, bis sich nichts mehr bewegte. Seine Oberarme waren so dick wie meine Schenkel, und ich habe selbst gesehen, wie er einen Zuhälter in einer bekannten Nuttenbar mit seinem Kopf zwischen dessen Beine unterlief und ihn über seinen Rücken durch das Fenster auf die Straße katapultierte. Paul soll wegen Totschlags gesessen haben und war im betrunkenen Zustand unberechenbar und gefährlich. Einmal kam seine Frau mit ihrem vierjährigen Kind an Bord und aus irgendeinem Grund verdrosch er sie mit einem 60 cm langen Kupferrohr. Da ich als Jungmann Nachtwache hatte, wollte ich irgendwie helfen und kam dabei selber in Lebensgefahr. Plötzlich holte er aus der Kombüse, wo wir Nachtwächter uns meistens aufhielten, das längste Fleischmesser und drückte mir die Spitze an den Kehlkopf. Da ich mit dem Rücken zur Wand stand, traute ich mich nicht zu bewegen, und nur durch gutes Zureden ließ er von mir ab. Im nüchternen Zustand war er ein guter Kumpel und der beste Heizer an Bord.
Stephan, der andere Heizer, wurde mein Freund an Bord. Er war 32 Jahre alt, dunkelhaarig und hatte eine große Ähnlichkeit mit dem Schauspieler Horst Buchholz, nur war er größer und kräftiger. Stephan war Zigeuner, die von den Nazis rassisch verfolgt worden waren, und er hatte nach Kriegsende bei der amerikanischen Armee als Hilfspolizist gedient. Er zeigte mir auch einmal seine amerikanischen Militärpapiere, die ihn als „Auxilary Policeofficer“ auswiesen. Wie er mir erzählte, hatte er nach der Kapitulation viele Deutsche mit der Waffe in der Hand vor Übergriffen ehemaliger polnischer Häftlinge gerettet. Solche ehemaligen Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge machten damals in Banden die Gegend unsicher. Seine junge Frau und seine kleine Tochter lebten in Vegesack an der Weser in einem Barackenlager. Er liebte beide abgöttisch. Stephan rauchte, trank und fluchte nicht und war ein zuverlässiger und fleißiger Mann. Für mich war er wie ein großer Bruder und wenn wir übers Wochenende in einem Hafen lagen und nicht gearbeitet wurde, gingen wir beide zusammen an Land und schauten uns die Museen und Sehenswürdigkeiten an. Stephan war immer ruhig, ausgeglichen und zurückhaltend. Wenn wir einmal mit unserem Schiff von Bremen nach See gingen und auf der Weser Vegesack passierten, stand Stephans ganze Familie und Sippe auf dem Deich und winkte, und Stephan strahlte dann glücklich.
Der Kapitän hieß Oltermann und war ein ruhiger, besonnener Mann, der nie die Beherrschung verlor und auch in den schwierigsten Situationen gute Nerven behielt. Er wurde von uns allen respektiert und hoch geachtet. Der 1.Offizier hieß Westenberger, war ein echter Ostpreuße und manchmal äußerst temperamentvoll. War ein Seemann renitent, trat er ihn ohne Hemmung in den Hintern. Da er recht groß und kräftig war, sorgte schon seine Anwesenheit für den nötigen Respekt. Er war ein ausgezeichneter Erster Offizier, gerecht und ein guter Vorgesetzter. Der 2.Offizier hieß Vorbeck, aber wir alle an Bord nannten ihn hinter vorgehaltener Hand den „Schnellen Bruno“. Er war ein gutmütiger Mensch mit Herz und Seele, und wir alle mochten ihn sehr. Einen 3.Offizier gab es nicht und der Erste und Zweite lösten sich alle sechs Stunden zur Wache ab. Der Kapitän ging keine Wache.
Der Leitende Ingenieur hieß Dickmann und war schon ein älterer Herr Ende fünfzig. Er war untersetzt, grauhaarig, hatte ein rundes rotes Gesicht und verbarg seine Gutmütigkeit hinter einem knurrigen Auftreten. Während des Krieges wurden zwölf seiner Schiffe, auf denen er sich befand, torpediert oder durch Bomben getroffen. Jedes Mal war er wieder aus dem Wasser gefischt worden. Die englische Gefangenschaft hatte er in Indien verbracht, und daher liebte er „Reis mit Curry“ über alles. Diese Kriegserlebnisse waren nicht spurlos an ihm vorbeigegangen, und er hatte einige Macken behalten. Wurde er einmal wütend, lief er ganz rot an und konnte ganz schön laut werden.
Der 1.Steward (wir hatten nur den einen) war Anfang dreißig und frisch verheiratet. Er hatte seinen Namen vorher amtlich von „Titt“ in „Braun“ ändern lassen, da man ihn früher an Bord nur „Brustwarze“ oder „Hängetitt“ genannt hatte. Dies wollte er seiner Frau ersparen. Er war für den Proviant und die Kantinenware zuständig, und ich bekam von ihm immer, was ich an „Freilager“ (Schnaps, Zigaretten ect.) brauchte.
Es gab morgens, mittags und abends reichlich warm zu essen, und es war das erste Mal, dass ich an Bord richtig satt wurde. Alle Arbeit wurde bezahlt und da wir zwei Junggrade billiger waren als die Matrosen, gingen auch wir auf See zwei Wachen. Dadurch konnten zwei Matrosen auf See Tagelohn gehen (normale acht Stunden), und die Reederei sparte eine Menge Geld. Durch diese Regelung machten wir Junggrade auf See jeden Tag vier Überstunden und mit den übrigen geleisteten Überstunden kamen wir manchmal im Monat auf 160 zusätzlich bezahlte Stunden. Mit der Heuer zusammen war das für mich, im Gegensatz zu meinem letzten Schiff, eine gewaltige Summe. Da ich ja vorher nichts anderes gewohnt war, törnte ich, wann immer es verlangt wurde, egal ob an Sonn- oder Feiertagen, ohne Murren zu, was auf den 1.Offizier großen Eindruck machte. Zum erstenmal hatte ich das Gefühl, nicht ausgenutzt und für meine Arbeit gerecht bezahlt zu werden.
Wir fuhren meistens Stückgut von Hamburg nach England, Irland und manchmal Koks und Kohle nach Dänemark. Ich fühlte mich an Bord wohl, und wir kamen alle gut miteinander aus. Wie mancher Kapitän hatte auch der unsrige eine Marotte und das war unsere Dampfpfeife am Schornstein. Da die Reederei Schuchmann damals die größte Bergungsfirma in Deutschland war, unterhielt sie auch so etwas wie einen „Wrackteilesammelplatz“ in Hamburg. Dort lagen unter anderem geborgene Anker, Ketten und Winden herum. Auch die Dampfpfeife eines großen ehemaligen Passagierdampfers mit einer Länge von etwa drei Metern fand sich dort. Dieses Monstrum ließ er an unsere „Angströhre“ (Schornstein) montieren. Nun muss man sich vorstellen, dass der ursprüngliche Träger dieser Dampfpfeife ein riesiges Passagierschiff war und unser Dampfer nur eine Verdrängung von knapp 2.000 Tonnen hatte. Ertönte im Nebel unsere Dampfpfeife, hörte sich das an, als ob die „Queen Mary“ in der Nähe wäre, und jedes Kümo sah zu, dass es Abstand gewann. Die Heizer an den Kesseln fluchten natürlich fürchterlich, da der Dampfdruck nach jedem Signal rapide abfiel und sie sofort tüchtig Kohlen nachwerfen mussten. Es war auch für mich das erstemal, dass ich mit Dampfwinden zu tun hatte. Bei denen musste man mit viel mehr Gefühl arbeiten als bei den Motorwinden. Besonders beim Fieren musste man gegebenenfalls mit dem Ventilrad Gegendampfdruck geben. Auch an das Rattern und Fauchen musste ich mich erst gewöhnen. Es klang wie die Geräusche einer Dampflok im Leerlauf. Auf See war es unheimlich ruhig, da man unsere Dampfhauptmaschine kaum hörte, und man konnte öfter denken, das Schiff läge gestoppt. Wollte man auf See oder im Hafen seine Wäsche waschen, nahm man nur einen Eimer voll kalten Wassers, etwas Seifenpulver und tat seine Wäsche hinein. Anschließend hielt man den Eimer ca. 5 Minuten unter das Stiemrohr an Deck und schon war die Wäsche gekocht. Stand man sich gut mit dem 1.Ingenieur oder der Maschinencrew, durfte man seine Wäsche zum Trocknen in die warme Zylinderstation auf das Geländer hängen und konnte sie nach drei Stunden wieder anziehen.
Wenn im Hafen nicht gearbeitet wurde, waren wir zwei Junggrade für die Petroleumlampen im ganzen Schiff zuständig, da die Dampflichtmaschine über Nacht abgestellt wurde. Je nachdem, wer von uns beiden Backschafts- oder Decksdienst hatte, musste die Petroleumlampen für die Messen, Logis, Kammern der Offiziere, Kombüse, Gangway und Hafenpositionslampen am Tage vorbereiten. Auch dies musste gelernt sein. Die Lampen wurden mit Petroleum gefüllt und die Dochte und Glaszylinder gereinigt. Anschließend mussten abends die Lampen angezündet, die Dochte getrimmt und die Flammen eingestellt werden. Lagen wir acht Tage oder mehr im Hafen, wurde diese Prozedur jeden Tag wiederholt.
Auf See hatte unser Dampfer bei starkem vorderlichen Wind oder Sturm mit seinen 9,5 Knoten Höchstgeschwindigkeit große Probleme und trat im günstigsten Fall auf der Stelle. Dann halfen auch noch so viele Schaufeln Kohle nicht, die Maschine brachte einfach nichts mehr. Im ungünstigsten Fall, wie einmal auf einer Reise von Hamburg nach England, wurde unser Dampfer bei starkem Wind und Strom auf eine Sandbank gedrückt. Da trieben wir tatsächlich rückwärts, obwohl die Maschine volle Kraft voraus lief. Wir wurden bei dieser Strandung leckgeschlagen. Zum Glück flaute der Wind ab und die Bilgenpumpen waren in der Lage, das Wasser, das in den Laderaum eindrang, abzupumpen. Es gelang uns auch, mit eigener Maschinenkraft von der Bank freizukommen, und der Alte entschied, sofort nach Hamburg zurückzukehren und ins Dock zu gehen. Kurz vor der Elbmündung nahmen uns zwei große Schlepper der eigenen Reederei auf den Haken und brachten uns bis ins Schwimmdock zu Blohm & Voss, wo man gleich mit der Reparatur begann, so dass wir nach zwei Tagen die Reise noch einmal antreten konnten.
Gefährlich waren damals auch die Minen, die als Erbe des Krieges noch zu Tausenden in der Nord- und Ostsee lagen. Man musste sich beim Navigieren strikt an die geräumten Zwangswege halten, wollte man nicht in die Luft fliegen. Gefährlicher und gefürchtet waren die vielen Treibminen, die sich nach jedem Sturm von ihrer Verankerung losgerissen hatten und dann überall unkontrolliert herumschwammen. Eines Tages wurde ich selbst Zeuge, wie ein Schiff auf eine solche Treibmine lief und unterging. Wir waren aus Bremen ausgelaufen und befanden uns, nachdem wir den Seelotsen abgesetzt hatten, an der Wesermündung, als es hinter uns einen lauten Knall gab. An einem roten Schiff, welches hinter uns folgte, stieg eine gewaltige Wasserfontäne auf und kurz darauf schrillte in unserer Funkkabine auf der Brücke die automatische Seenotalarmglocke. Dieses Signal wird ausgelöst, wenn ein in der Nähe befindliches Schiff auf einer bestimmten Frequenz SOS sendet. Unser Alte stoppte sofort unseren Dampfer, und wir konnten sehen, wie das dänische Küstenmotorschiff „Ethiel Danielsen“ tief im Wasser lag und die Leute in das Rettungsboot stiegen. Der Alte rief über Funk einen Bergungsschlepper unserer Reederei, der in Bremerhaven lag, herbei. Aber als der die Unglücksstelle erreichte, war es schon zu spät. Die „Ethiel Danielsen“, die sich auf ihrer ersten Reise befand, lag schon mit dem Deck unter Wasser und versank kurz darauf in die Tiefe. Von der Besatzung war, Gott sei Dank, niemand zu Schaden gekommen. Sie wurde in ihrem Rettungsboot vom Lotsenversetzschiff aufgenommen.
Beförderung zum Leichtmatrosen
Nach fast sechs Monaten Fahrzeit auf der „Hoheweg“ hatte ich mein Jahr als Jungmann voll und wurde zum Leichtmatrosen befördert. Ich blieb noch zwei Monate an Bord und musterte dann nach fast acht Monaten Fahrzeit in Hamburg ab, um nun endgültig auf Große Fahrt zu gehen.
Wieder nahm ich in dem mir nun schon gut bekannten Seemannsheim in Altona an der Großen Elbstraße Quartier und teilte mir dort ein Zimmer mit drei anderen Seeleuten. Meine Mitbewohner „lagen“ schon eine Zeitlang an Land und hatten, wie man sagt, „keinen Pfennig mehr auf der Naht“. So war ich für sie, der ich gerade abgemustert hatte, ein willkommener Zimmergenosse. Da sie schon seit Tagen nichts Anständiges mehr gegessen hatten, kaufte ich uns erst mal ordentlich Proviant, und sie hauten rein, wie ein Dutzend ausgehungerter Löwen. Sie erzählten mir, dass „auf dem Stall nichts los“ und es zur Zeit sehr schwierig sei, ein neues Schiff zu bekommen. Da ich, frisch abgemustert, noch über ausreichende Barschaften verfügte, wollte ich erst einmal ausspannen und machte mir keine großen Gedanken über die Zukunft.
Meine drei Zimmergenossen spiegelten das Bild des damaligen typischen deutschen Seemannes wieder. Der Älteste der drei war Schiffskoch, hieß Alfred und war Anfang dreißig. Während des Krieges war er als junger Soldat in Norwegen stationiert gewesen und hatte sich nach der Kapitulation in einem kleinen Dorf bei seiner norwegischen Freundin sieben Jahre versteckt gehalten. Nach seiner Entdeckung wurde er nach Deutschland abgeschoben, wo er als gelernter Koch bei der Seefahrt Arbeit fand. Da er inzwischen fließend norwegisch sprach, hatte er später auf einem skandinavischen Schiff angemustert und sehr gut verdient. Aber wie bei so vielen Seeleuten war ihm das Geld nach der Abmusterung schnell durch die Finger geronnen, und jetzt stand er fast ohne Pfennig da. Er war ein kleiner lebhafter Bursche und mit seinem schwarzen Haar und dunklem Taint hätte man ihn glatt für einen Italiener halten können. Als Kettenraucher war er immer auf der Jagd nach einem Glimmstengel und auch nicht bange, die Leute auf der Straße um eine Zigarette anzuhauen. Alfred war mit allen Wassern gewaschen und konnte reden wie ein Buch. Er war ein guter Kumpel und wenn er im Hafen auf einem norwegischen Schiff etwas ergattert hatte, teilte er es bedenkenlos mit uns.
Der zweite Zimmerkollege, Martin, war 28 Jahre alt, hatte vor der Seefahrt Schlosser gelernt und fuhr als Schmierer in der Maschine. Er war mittelgroß, dunkelhaarig und ein ruhiger, nachdenklicher Typ. Martin trank überhaupt nicht und war ein grundsolider Mensch. Er hatte eine Freundin in Hamburg, die ihn unten am Hauseingang täglich besuchte und so gut sie konnte, unterstützte. Der Dritte wurde „Blondy“ genannt, war etwa 26 Jahre alt, 1,80 Meter groß, athletisch gebaut, hatte volles hellblondes Haar und fuhr als Matrose. Er verkörperte den typischen „Hein Seemann“, trank gerne einen, wenn er Geld hatte und da er immer nur für kurze Zeit über „Kohle“ verfügte, ließ er sich auf St. Pauli von den Mädchen einen ausgeben, denn er hatte den richtigen Ton für sie und konnte prächtig mit ihnen umgehen. Hatte eine von den Damen Schwierigkeiten mit irgend einem Kerl, erwachte in ihm sofort der Beschützerinstinkt. Da er Kräfte wie ein Stier hatte, regelte er die Sache für sie. Wenn er gewollt hätte, wäre jede von ihnen für ihn „anschaffen“ gegangen, aber er hatte nicht das Zeug für einen Zuhälter, war einfach nur ein typischer „Hein Seemann“, der seinen Spaß haben wollte. Er rauchte nicht, brachte aber den anderen beiden immer Zigaretten von seinen nächtlichen Exkursionen mit. Ging es meinen Zimmerkollegen ganz schlecht, meldeten sie sich bei den Fischhallen zur Nachtschicht beim „Vereisen“, - eine mörderische Arbeit, für die immer Leute gesucht wurden. Für ca. 20 Mark stand man in unzulänglicher Kleidung bei eisiger Kälte in der Fischhalle und schaufelte zwölf Stunden lang im Akkord Eis zwischen die Fischkisten. Total erschöpft und blaugefroren tauchten sie am nächsten Morgen auf und verschwanden frierend unter der Bettdecke.
Da auch mein Geld nach 14 Tagen rapide abnahm, ließ ich mich auf dem „Stall“ sehen, der jetzt wieder im „Weißen Haus“ (Hamburger Seemannshaus, heute „Hotel Hafen Hamburg“) in der Nähe der früheren Seewarte parallel zu den Landungsbrücken oben auf dem Berg untergebracht war. Im Gegensatz zur alten Heuerstelle am Baumwall hatte sich räumlich einiges geändert. Der Warteraum, ähnlich dem eines Bahnhofes, war größer und geräumiger und besaß zwei Klappen. Man musste sich an einer Klappe anmelden und bekam eine Nummer zugeteilt und einen Datumstempel auf die Rückseite des Seefahrtbuches gedrückt. Danach musste man sich täglich zwischen 8 und 13 Uhr auf dem „Stall“ bereithalten. Irgendwann zu einer bestimmten Zeit wurden die Seefahrtbücher eingesammelt und kontrolliert, ob man auch anwesend war. Fehlte man bei so einer Kontrollaktion, wurde man nummernmäßig zurückgestuft und musste wieder länger auf ein Schiff warten.
Der neue Heuerbaas hieß Max Timm und wurde Generationen von Seeleuten als „Max“ ein Begriff. Er war und blieb eine der gefürchtetsten und gehasstesten Personen bei allen Seeleuten an der Küste. Max war damals Mitte vierzig, untersetzt, hatte ein grobes steinernes Gesicht und grobschlächtiges Auftreten. Er strahlte immer schlechte Laune aus, duzte grundsätzlich jeden und benahm sich wie ein Despot. Hatte er einen „auf Sicht“, konnte er sehr nachtragend und gemein werden, und sein Opfer konnte dann lange auf ein Schiff warten, was nicht selten zur Verelendung führte. Wie groß der Groll gegen ihn war, zeigte auch die unbestätigte Story, dass ihm 20 Jahre später als altem Mann bei seiner Verabschiedung ein alter Seemann vor großer Versammlung beim Verlassen des Saals ein blaues Auge geschlagen haben soll.
Gleich neben dem „Stall“ befand sich, durch einen Gang getrennt, ein Bierlokal, wo sich gerne eine große Menge der arbeitsuchenden Seeleute, sofern man noch Geld hatte, aufhielt. Wurde eine Nummer aufgerufen oder ein Seemann namentlich gesucht, konnte man die Durchsage über einen im Lokal angebrachten Lautsprecher hören und rechtzeitig zum Heuerstall hinüberlaufen. In diesem Bierlokal wurde teilweise das letzte Geld versoffen, und es ging dort oft heiß her. Hier war auch die Informationsküche der Seeleute, da immer jemand zu finden war, der sich bei dieser oder jener Reederei gut auskannte. Viele der damaligen deutschen Reedereien hatten bei den Seeleuten ihre Spitznamen. Wenn jemand sagte, er habe bei „Knapp & Billig“ gefahren, so wusste man, dass damit die alte Hamburger Reederei „Knöhr & Burchard“ gemeint war. Ein anderer Deckname hieß „Schurken und Banditen“. Manchmal kamen auch gerade abgemusterte Seeleute mit noch gefüllten Taschen und ihren Damen herein, und dann ging es bis spät in den Abend hinein hoch her. Bemerkenswert war auch der Kellner „Schorsch“, ein großer, seriös aussehender Mann, Anfang Fünfzig, der immer eine frisch gebügelte Hose und Jacke mit Krawatte trug. Er hatte das Auftreten eines englischen Butlers und war bei den Seeleuten sehr angesehen. Auch besaß er ein sagenhaftes Gedächtnis und war grundehrlich. Für uns alle blieb er ein Rätsel, denn er soll Besitzer eines Taxiunternehmens gewesen ein, welches genug Geld abwarf. Vielleicht war es die besondere Atmosphäre, die es ihm dort angetan hatte. Wir jedenfalls trauten im voll, und ich habe niemals erlebt, auch später nicht, dass irgendeiner seine Rechnung bei ihm angezweifelt oder gewagt hätte, ihn zu beleidigen. Wir alle hätten jenen aus dem Lokal geworfen.
Meine Barschaft hatte unterdessen den Stand meiner Zimmergenossen erreicht und ich machte mir ernstlich Sorgen, wie es weitergehen sollte. Als erstes verkaufte ich meinen neuen Fotoapparat, den ich mir auf meinem letzten Schiff zugelegt hatte und der meinen wertvollsten Besitz darstellte. Alfred erzielte für das gute Stück bei einem An- und Verkaufsladen auf dem Großneumarkt 38 DM, und wir vier konnten uns davon eine Zeitlang über Wasser halten. Wenn ich heute jemandem erzähle, dass wir vier Personen uns damals pro Tag zusammen von 2,- DM verpflegten, glaubt es niemand, aber es ging, und wir überlebten. Einer von uns ging jeden Tag zu den Fischhallen und kaufte dort für 1,50 DM ca. 3 kg geräucherte „Bruchbücklinge“. Das waren Bruchstücke geräucherter Heringe, die beim Transport oder Verladen zu Bruch gekommen waren und nur noch aus kleinen Stücken bestanden. Da sie zum Verkauf nicht mehr geeignet waren, wurden sie normalerweise weggeworfen. Aber an uns arbeitslosen Seeleuten war daran noch etwas zu verdienen, und so war dieser Abfall die einzige Nahrung, die wir uns noch leisten konnten. Für die restlichen 50 Pfennige kauften wir uns Brötchen, die damals noch für 5 Pfennig das Stück zu haben waren, und tranken dazu „Gänsewein“, den es kostenlos und reichlich aus der Wasserleitung gab. Wir wurden einigermaßen satt, aber alles roch nach ein Paar Tagen nach Räucherfisch, selbst unser Schweiß und Urin. Irgendwann kam der Tag, an dem ich auf Jahre hinaus einen Groll gegen Bücklinge bekam. Bei dem Geruch sträubten sich schon meine Nackenhaare.
Tagsüber lungerte ich bis zum Mittag auf dem „Stall“ herum, immer in der Hoffnung, ein Schiff zu bekommen. Einmal lud mich ein Seemann zu einem Bier ein. Es wurden mehrere und da ich sonst nichts im Magen hatte, kam ich sternhagelvoll zurück und hatte am nächsten Tag einen furchtbaren „Kater“. Da auf dem „Großen Stall“ Flaute herrschte, ließ ich mich eines Tages auf dem „Kleinen Stall“ sehen, auch wenn ich mir geschworen hatte, nie wieder auf Kümos zu fahren. Der „Kleine Stall“, die Heuerstelle der Küstenschifffahrt befand sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu unserem Altonaer Seemannsheim in einem schäbigen Gebäude in der Großen Elbstraße. In einem kleinen Warteraum im ersten Stock lungerten etwa dreißig Seeleute herum. Der Heuerbaas hieß, glaub ich, Heithoff, war selbst Kapitän und besaß ein eigenes Kümo. Er war Mitte vierzig, besaß nur noch einen Arm und hatte das typische Gehabe eines „Kümoschippers“. Ich hatte mich gerade in den Warteraum gesetzt, da stürzte er aus seinem Büro und schrie: „Einen Moses!“ Als drei, vier junge Burschen aufsprangen, deutete er auf einen, zeigte dabei auf einen Besen und Kehrschaufel in der Ecke und befahl ihm in barschem Ton, den Warteraum und das Büro zu fegen. Er konnte seine Zunft nicht verleugnen.
Ein anderes Mal hatte er zwei Kümokapitäne bei sich im Büro zu sitzen, die zwei Junggrade suchten. Sie kamen alle drei heraus, und der Heuerbaas zeigte auf zwei junge Burschen. Der eine Kapitän schaute sie sich wie ein Pferdekäufer von allen Seiten an und zeigte dann auf einen großen stiernackigen Kerl mit naivem Gesichtsausdruck. Er befahl ihm aufzustehen und ging dann um ihn herum, begutachtete ihn fachmännisch von allen Seiten, bis er dann entschied: „Den nehm ich, der hat was in der Mau, der kann ordentlich was schleppen.“ Was er an Bord schleppen sollte, entzog sich meiner Kenntnis. Der andere Kapitän entschied sich für einen untersetzten Burschen, der wie ein abgebrochener Riese aussah, und ich stellte mir so ungefähr einen Sklavenmarkt in den Südstaaten oder bei den alten Römern vor. Fluchtartig verließ ich den kleinen Stall und ließ mich dort nie wieder im Leben sehen.
Uns Vieren ging es nun wirklich schlecht, und wir teilten uns jetzt sogar Seife, Zahnpasta und Rasierklingen. Wir lebten im Seemannsheim sehr preisgünstig, aber obwohl es der Deutschen Seemannsmission gehörte und unsere miese Situation bekannt war, habe ich es nie erlebt, dass man uns eine Mahlzeit gespendet hätte. Nachts, wenn wir schliefen, mussten wir höllisch aufpassen, dass wir nicht von Kollegen, unter denen es auch Strolche gab, beklaut wurden. Da wir unsere Zimmertür wegen des defekten Schlosses nicht abschließen konnten, stellten wir, bevor wir uns zu Bett legten, leere Flaschen an die Tür. Klöterte es nachts, sprangen wir alle auf und wenn wir den Störenfried zu fassen kriegten, setzte es eine ordentliche Tracht Prügel. Einen Spitzbuben erwischten wir einmal mit Martins einziger Hose an der Treppe und gaben ihm eine tüchtige Abreibung.
Das einzige Vergnügen, welches ich mir ab und zu leistete, war ein Besuch der „Catch“-Veranstaltungen in einem Zelt am Millerntor. Das „Catchen“ (heute sagt man „Wrestling“) fand in einem großen Zelt statt, und für eine Mark bekam man als Arbeitsloser in der 16-Uhr-Vorstellung einen Stehplatz. Ich war damals so begeistert von den Kämpfen, dass ich sogar auf meine „Mahlzeit“ verzichtete und mir für die eine Mark eine Karte leistete.
Die Veranstaltungen waren gut aufgemacht und fast immer ausverkauft. Vor Beginn eines Kampfes wurde der „Gladiatorenmarsch“ abgespielt, und die Kämpfer wurden mit ihrem Suggestivnamen vorgestellt: „Der Würger“, „Prinz von Malo“ oder „Rasputin“. Einige der Kämpfer wurden mit einer geheimnisumwitterten Aura umgeben: Der „Würger“, der nur mit einer Maske kämpfte, sollte angeblich eine bekannte hohe Persönlichkeit sein. „Ali“ wurde als verstoßener Sohn eines Emirs vorgestellt, der vor jedem Kampf in der Arena wirkungsvoll auf einem kleinen Teppich zu Allah „betete“. Die Menge glaube es, und jeder hatte seinen Favoriten, den er begeistert anfeuerte. Auch die Damen von St. Pauli, die erst am Abend zur „Arbeit“ gingen, waren bei den Nachmittagsvorstellungen stark vertreten. Wie wir, hatten auch sie ihre besonderen Lieblinge, die sie mit deftigen und schrillen Rufen anfeuerten. Manche gerieten dabei außer Rand und Band. Manchmal ergatterte ich während der Vorstellung einen leeren Sitzplatz und so habe ich selbst erlebt, dass einige Damen hinter mir ganz hysterisch reagierten, als ein großer athletischer Neger mit Namen „Bongo“ von seinem Gegner aufs Kreuz gelegt wurde. Die Damen hämmerten mit ihren Fäusten auf meinen Rücken ein und schrieen: „Blacky, reiß ihm die Eier raus, mach ihn fertig, reiß ihm den Schwanz ab!“
Der absolute Favorit und Liebling der Damen war ein großer, dunkelhaariger, gut aussehender junger Spanier mit einer Prachtfigur, der „Don Carlos de la...“ genannt wurde. Uns wurde erzählt, er sei der uneheliche Sohn eines reichen verstorbenen spanischen Grafen, der noch immer um sein Erbteil kämpfe, um das man ihn betrogen habe. Als „Negativgegner“ dieses Prachtexemplars hatte die Regie einen „Fiesling“ ausgesucht, der allein schon durch sein Aussehen Antipathie hervorrief. Brachte dann dieser Fiesling den Schönling durch einen fiesen, heimtückischen Angriff zu Boden, rastete die versammelte „Damenhalbwelt“ jedes Mal vor Wut aus. Ich wunderte mich immer wieder, dass diese entfesselten Furien nicht in den Ring stürmten. Am Ende siegte der Schönling und die Damen verließen befriedigt die Arena, um am Abend rechtzeitig auf der „Meile“ zu sein.
Ich lungerte, wie jeden Tag, vormittags auf dem „Stall“ herum und wollte mich kurz vor Mittag schon entmutigt auf den Heimweg machen, als plötzlich meine Nummer und mein Name aufgerufen wurden. Als ich zur Klappe stürzte, blickte ich in das steinerne, ausdruckslose Gesicht von „Max“, der mir mitteilte, dass ich als Leichtmatrose auf das Motorschiff „Ilse E. Gleue“ gehen könne. Das Schiff wäre ein Jahr alt und in der Mittleren und Großen Fahrt eingesetzt. Er fragte mich, ob ich an Bord gehen wolle, und ich antwortete sofort mit „Ja!“, denn bei „Max“ durfte man nicht lange zögern oder Fragen stellen, sonst war man schnell weg vom Fenster. Ich holte mir an der hinteren Klappe zum Büro meinen Heuerschein ab und sollte mich am nächsten Tag um 10.00 Uhr mit meinem Gepäck auf dem Hauptbahnhof am Zugang zum Bahnsteig 8 einfinden. Dort würden dann auch der Reedereivertreter und die übrigen neuen Besatzungsmitglieder sein. Fahrkarte und Reisespesen von 8,-- DM pro Mann bekämen wir auf dem Bahnhof vom Vertreter der Reederei.
Am Abend packte ich meine Sachen in den Seesack. Der Inhalt bestand zum großen Teil aus schmutziger Wäsche, da wir im Seemannsheim kaum Möglichkeit fanden, unsere Sachen vernünftig zu waschen. Wir wuschen unsere zwei Garnituren Unterwäsche, Socken und Hemden jeden Tag abwechselnd unter dem kalten Wasserhahn. Anschließend hängten wir sie zum Trocknen über unsere Stühle, auf die Heizung oder wo sonst im Zimmer Platz frei war. Jeder kann sich selber ausmalen, wie es bei uns vier Mann auf der Bude ausgesehen haben mag. Meinen einzigen Anzug, den ich mir auf der „Hoheweg“ zugelegt hatte, rollte ich in ein Handtuch und verstaute ihn zuletzt im Seesack. Alles was ich entbehren konnte, es war nicht viel, überließ ich meinen Zimmerkollegen. Am nächsten Morgen verabschiedete ich mich von ihnen, die mir wirklich gute Kameraden gewesen waren und die alte Volksweisheit bestätigt hatten, dass man in der Not den wahren Freund erkennt. Kurz vor 10 Uhr traf ich auf dem Hauptbahnhof ein, wo schon einige der neuen Crew für M/S „Ilse E. Gleue“ warteten. Unsere Reisegruppe bestand aus einem Bootsmann, einem Matrosen, einem 1.Koch, zwei Mann vom Maschinenpersonal und mir als Leichtmatrosen. Der Reedereivertreter unterrichtete uns, dass unser Schiff in Genua (Italien) an der Kai lag und händigte uns kurz vor der Abfahrt des Zuges die Fahrkarten und das Geld für Reisespesen aus. Vorher beschrieb er uns genau den Liegeplatz unseres Schiffes.
Unterwegs machten wir uns bekannt, passierten ohne Schwierigkeiten die deutsch-schweizerische Grenze und befanden uns nun auf der Fahrt ins sonnige Italien. Der Bootsmann, der ja mein unmittelbarer Vorgesetzter sein würde, kam aus Wyk auf Föhr und machte einen ruhigen, ausgeglichenen und vernünftigen Eindruck, der sich auch später bestätigte. Er war über 40 Jahre alt, Witwer und hatte zwei Söhne. Im Sommer fuhr er, wie er uns erzählte, mit seiner eigenen Barkasse, die „La Paloma“ hieß, Urlauber bei Kaffee und Kuchen spazieren. Den Herbst und Winter über, wenn zu Hause das Wetter schlecht wurde, arbeitete er als Bootsmann bei verschiedenen Reedereien. Er war ca. 1,80 m groß, dunkelhaarig und hatte ein markantes Gesicht. Er rauchte, fluchte und trank nicht und war, wie sich herausstellen sollte, der ideale Bootsmann. Sein Nachname war Steffen. An seinen Vornamen kann ich mich nicht mehr erinnern. - Der Matrose hieß Helmuth, war ca. 24 Jahre alt und kam aus dem Raum Uetersen im südlichen Schleswig-Holstein. Sein Vater besaß, wie er uns erzählte, eine Druckerei, die gut florierte. Warum er zur See fuhr, war uns ein Rätsel. Er besaß eine höhere Schulbildung und wollte so schnell wie möglich sein Steuermannspatent A5 machen.
Den 1.Koch will ich „Conny“ nennen. Er war ca. 45 Jahre alt und einer der merkwürdigsten Leute, denen ich je in der Seefahrt begegnet bin. Mit seiner Brille und seinem grauen Anzug mit Krawatte sah er eher wie ein Arzt aus, und er hätte nach dem Äußeren ein Zwillingsbruder des bekannten TV-Quizmeisters Robert Lembke sein können. Auch Jahre später fiel mir immer wieder diese verblüffende Ähnlichkeit auf. „Conny“ hatte eine angenehme Stimme, sprach fließend französisch und hatte vor dem Krieg bis zu seiner Einberufung Medizin studiert. Er hatte eine abenteuerliche Vergangenheit und, in der französischen Gefangenschaft vor die Wahl gestellt, einige Jahre in der Fremdenlegion gedient. Obwohl er verheiratet war, stellte sich heraus, dass er bisexuell veranlagt und außerdem versoffen war. Auf eine bestimmte Sorte von Frauen, denen wahrscheinlich die normalen sexuellen Varianten keine Abwechslung mehr brachten, wirkte Conny ungemein anziehend. Es muss eine unsichtbare Aura von ihm ausgegangen sein, die solche Frauen sofort wahrnahmen und der Volksmund sagt ja nicht umsonst, dass „ein Hund immer den anderen riecht.“
Der Zufall wollte es, dass wir bereits auf unserer Zugreise in unserem Abteil Zeuge eines solchen Vorgangs wurden. Da wir damit rechneten, am frühen Morgen in Genua zu sein, gingen wir mit unseren Reisespesen ziemlich großzügig um. Wir bestellten uns beim Zugkellner einige Lagen Bier, und es dauerte gar nicht lange, bis es in unserem Abteil ziemlich lustig zuging. Auf irgend einer Station stieg eine elegante Dame mit ihrer sechsjährigen Tochter in unser Abteil. Sie war ca. 30 Jahre alt, blond, hatte eine atemberaubende Figur und ein schönes klassisches Gesicht, wie man es oft bei Filmstars sehen kann. Wir starrten sie an und wunderten uns, wie sich dieses Wesen aus einer anderen Welt in unser verräuchertes Abteil verirren konnte. Es dauerte nicht lange, bis uns Conny bei ihr als Seeleute vorgestellt hatte. Sie selbst erzählte uns, dass sie deutsche Schauspielerin sei, in vielen Filmen mitgewirkt habe und zur Zeit hier in der Schweiz ein Engagement an einem Theater habe. Einige von uns erinnerten sich, sie schon im Kino gesehen zu haben und wir bestellten uns daraufhin gleich noch eine Lage Bier. Während wir lustig weiterzechten, spielte ihr Töchterchen draußen im Gang. Unser Star hatte sich indessen ganz auf Conny konzentriert, und beide führten eine angeregte Unterhaltung.
Etwa eine Stunde, bevor sie aussteigen musste, fragte sie plötzlich Conny unverblümt, ob er sie nicht draußen in der Toilette „fi....“ könne. Wir alle waren wie vom Donner gerührt und starrten sie mit offenem Mund ungläubig an. Nicht aber unser Conny, der sie ganz selbstverständlich am Arm fasste und mit ihr nach draußen verschwand. Sie hatte keinen Schluck Alkohol getrunken, und wir Verbliebenen konnten es einfach nicht fassen, was wir eben erlebt hatten. Selbst uns abgebrühten Seeleuten verschlug es die Sprache. Nach ca. 20 Minuten kamen die beiden wieder zurück und setzten die Unterhaltung fort, als ob nichts gewesen wäre. Gut eine halbe Stunde später erreichten wir ihre Station, und sie verabschiedete sich herzlich von uns, gab Conny einen dicken Kuss und verschwand mit ihrer Tochter, die die ganze Zeit über im Gang gespielt hatte.
Um Mitternacht erreichten wir Chiasso an der schweizerisch-italienischen Grenze und bekamen bei der Passkontrolle enorme Schwierigkeiten. Da wir kein italienisches Einreisevisum hatten, wollten uns die italienischen Beamten nicht einreisen lassen, und wir mussten aus dem Zug. Da half auch kein noch so dringender Appell, dass wir eventuell unser Schiff nicht mehr erreichen könnten. Die Beamten blieben stur. Am Montag könnten wir ja in Chiasso beim italienischen Konsul ein Visum beantragen, und dann wäre alles kein Problem. Unser Hinweis, dass wir keinen Pfennig für ein Visa besäßen, ließ sie kalt. Wir quartierten uns in der Bahnhofshalle ein. Da es Sonnabend war, machten wir uns auf eine harte Zeit gefasst. Da wir sowieso nichts machen konnten, versuchten wir, so gut es ging, auf den harten Bänken zu schlafen. Mit unseren Seesäcken neben uns hatten wir einen erheblichen Teil der sowieso nicht großen Wartehalle für uns besetzt und alle Augenblicke kam die Bahnpolizei und kontrollierte unsere Papiere und Seefahrtbücher, so dass wir nicht all zu viel Schlaf bekamen. Auch die Bahnpolizisten bestätigten uns, dass wir bis Montag warten müssten, da das italienische Konsulat über das ganze Wochenende geschlossen sei.
Wir waren sehr deprimiert, denn wir mussten damit rechnen, unser Schiff zu verpassen. Am Morgen schlichen wir unausgeschlafen, ungewaschen, unrasiert und mit knurrenden Mägen durch die Wartehalle. Es war Sonnabend, und die Halle füllte sich mit Reisenden, die übers Wochenende nach Italien wollten und uns neugierig anstarrten. Wir warfen unsere letzten Rappen zusammen und konnten uns dafür eine Tasse Kaffee und ein trockenes Brötchen leisten. Am schwersten hatte es Conny als Kettenraucher, der jeden, den er rauchen sah, um eine Zigarette anbettelte. Wegen seiner französischen Sprachkenntnisse hatte er auch meistens Erfolg. Am Mittag hatten wir furchtbaren Kohldampf, aber es gab nichts und niemand erbarmte sich unser. Nur am Nachmittag spendierte uns eine ältere Kellnerin im Bahnhofsrestaurant an der Hintertür eine Tasse Kaffee. Als es dunkel wurde, gingen wir wie die Tiere auf Nahrungssuche und fanden einen einsamen Garten, den wir heimsuchten. Da es dort nur Karotten und rohen Kohlrabi gab, mussten wir uns damit begnügen. Nach dem zweiten Kohlrabi musste ich mich furchtbar übergeben, hatte anschließend aber wenigstens kein Hungergefühl mehr.
Langsam hatte sich unsere Situation herumgesprochen, und es kamen einige Leute, die uns wie Exoten anstarrten, aber nicht einem dieser rechtschaffenen Leute fiel es ein, uns eine Mahlzeit zu spendieren oder sonst zu helfen. Wegen dieser sparsamen Eigenschaft der Eidgenossen scheinen auch die schweizerischen Bankiers so erfolgreich in der Welt zu sein. Am späten Nachmittag erfuhren wir, dass der italienische Konsul wieder zurück sei und am Abend aus irgend einem offiziellen Anlass eine große Party geben würde. Da sich vor dem Konsulargebäude auch einige Reporter aufhielten, versammelten wir uns am Gittertor und baten einige von ihnen um Hilfe. Besonders Conny schilderte ihnen unsere Situation in düstersten Farben. Mit einigen Journalisten im Schlepp ging Conny mit unseren Seefahrtbüchern und Heuerscheinen ins Gebäude und kam nach einer halben Stunde mit unseren Einreisevisa zurück. Wie uns Conny erzählte, wollte sich der Konsul erst querstellen, aber die Anwesenheit der Presse überzeugte ihn schließlich, so dass er uns die Gebühren, die wir ohnehin nicht hätten zahlen können, erließ. Also nichts gegen die Macht der freien Presse.
Am Abend konnten wir endlich unseren Zug besteigen und erreichen diesmal ohne weiteren Zwischenfall Genua und unser Schiff, das noch an seinem Liegeplatz wartete. An Bord wurden wir von der abzulösenden Crew, die bereits fast ein Jahr an Bord war, schon sehnsüchtig erwartet. Nachdem wir uns beim 1.Offizier, 1.Ingenieur und Kapitän gemeldet hatten, begaben wir uns in unsere Kammern. Die „Ilse E. Gleue“, besaß nur Zweimannkammern und ich teilte meine mit dem Matrosen Helmuth, mit dem ich mich ganz gut verstand. Die Kammer hatte zwei übereinanderliegende Kojen, wobei ihm dienstgradmäßig die untere zustand. Außerdem besaß sie ein Waschbecken mit Kalt- und Warmwasser, sowie zwei Kleiderschränke, einen Tisch und eine lange Sitzbank, worauf man sich zur Not auch legen konnte. Der bisherige Koch hatte für uns ein Empfangsessen vorbereitet und nachdem wir wie ein Rudel ausgehungerter Wölfe darüber hergefallen waren, war die Welt wieder in Ordnung.
Das Motorschiff „Ilse E. Gleue“ gehörte der Reederei „Gleue & Detjen“, die zu den besten in Deutschland zählte. Wir bekamen als Mannschaftsgrade Bettzeug gestellt, und der Verpflegungssatz ging weit über die vorgeschriebenen Mengen der Speiserolle hinaus. Ich habe bis heute nicht verstanden, warum die meisten deutschen Reeder im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Reedereien, was Verpflegung und Bezahlung anbelangt, so furchtbar knauserig waren. Sie verpflegten nach einer unzeitgemäßen und weit überholten Speiserolle, die in einer Zeit verordnet worden war, als ein Ei noch zu den Luxuslebensmitteln gehörte. Die Frachtraten waren international gleich, und ein schwedischer Reeder bekam für die Tonne genau so viel Frachtvergütung, wie der deutsche Reeder. Trotzdem bekam der schwedische Seemann eine höhere Bezahlung und eine bessere Verpflegung als der deutsche. An der Gewinnspanne für Fracht kann es also nicht gelegen haben. Ich jedenfalls fühlte mich hier an Bord im Vergleich zu meinen bisherigen Schiffen, wie in einem „First Class Hotel“, denn wo hatte man damals schon auf deutschen Schiffen Zweimannkammern mit fließend Kalt- und Warmwasser? Von Bettzeug und Handtüchern gar nicht zu reden.
Unser Alter zählte etwa 50 Jahre und war einer der rätselhaftesten Menschen, die mir je im Leben begegnet sind. Er war mittelgroß, drahtig und sein Kopf ähnelte einer Büste von Julius Cäsar, die ich einmal in einem Museum gesehen hatte. Er besaß die gleichen markanten Gesichtszüge und die hohe Stirn dieses römischen Herrschers. Man behauptete, dass der Schauspieler Otto Gebühr eine verblüffend große Ähnlichkeit mit Friedrich dem Großen hatte. Wenn das so war, dann wäre unser Alter die ideale Besetzung Cäsars gewesen. Überhaupt war sein ganzes Auftreten und Gebaren eines Cäsaren würdig. Er strahlte ungemein viel Autorität aus und wenn er einen Raum betrat, wurden alle Anwesenden automatisch ruhig. Seine Anweisungen kamen kurz und präzise, und seine Stimme klang wohltönend und sonor. Er war hochintelligent und sprach fließend englisch, französisch, spanisch, italienisch und Latein. Seine Kammer war mit Büchern übersät, und er war immer dabei, irgend etwas zu berechnen oder zu verbessern.
Während des Krieges war er Marineoffizier gewesen, und sein ganzes Verhalten war militärisch und autoritär. Lief er in einen Hafen ein oder aus, stand er in voller Montur, bestehend aus Uniformjacke mit den vier „Kolbenringen“ (Goldstreifen) am Ärmel, weißem Hemd mit Krawatte, dunkler Hose, Mütze und, als ein Tribut an seine Marinezeit, mit halblangen U-Bootstiefeln auf der Brücke. War er wieder auf See und es war warm, lief er nur mit einer Badehose bekleidet herum. Besatzungsmitglieder, die schon länger an Bord waren, berichteten uns, dass sie einmal in Tunis mehrere Tage zum Löschen gelegen hatten und der Alte drei Tage verschwunden gewesen sei. Man habe ihn in abgetragenen Klamotten im Araberviertel herumlungern sehen, wo er wohl seine arabischen Studien betrieben haben wird. Beim Auslaufen aus Tunis stand er jedenfalls wieder in vollem Wichs auf der Brücke. Man sagt, dass Genie und Wahnsinn dicht beieinander lägen. Etwas Wahres ist schon dran, aber davon später.
Der 1.Offizier hieß Krambs, war Anfang vierzig, untersetzt und gebürtiger Bayer. Man hätte ihn sich ohne weiteres mit Lederhosen und Gamsbarthut vorstellen können. Er war ein hochdekorierter ehemaliger Marineoffizier, der das große Kapitänspatent A6 für Handelsschiffe besaß und einer der besten Ersten Offiziere war, die ich in meiner Seefahrtzeit kennen gelernt habe. Er war ruhig, menschlich und gerecht. Wir verehrten ihn sehr, und es gab niemanden von der Deckscrew, der für ihn nicht durchs Feuer gegangen wäre. Außerdem besaß er trotz allem die nötige Härte, die sein Beruf von ihm verlangte. Es war die Portion Verständnis für uns, die ihn so sympathisch machte.
An den Namen des 2.Offiziers kann ich mich nicht erinnern, habe ihn auch nicht im Tagebuch notiert. Er war auch Anfang vierzig, groß und sehr unbeliebt. Wir nannten ihn wegen seiner Hasenscharte und seines poltrigen Wesens nur „Polterlippe“ und waren froh, wenn wir nicht mit ihm Wache gehen mussten, denn er war ein ewiger Nörgler und meldete jede Unachtsamkeit und jeden Fehler sofort dem Alten.
Auch der Name des 3.Offiziers ist mir entfallen. Er war Mitte dreißig, schlank, sah schneidig aus und war ebenfalls ehemaliger Marineoffizier, der während des Krieges auf Schnell- und Minensuchbooten gefahren haben soll. Wir mochten ihn leiden, da wir auf seiner Wache rauchen durften und es nicht so steif zuging. Da er von Handelsschifffahrt und Ladung nicht so viel verstand, ließ er uns in Ruhe und beschränkte sich nur auf seine Wache.
Der 1.Ingenieur, der ja Leitender Ingenieur war, hieß nach meiner Erinnerung Sanders, war ca. 30 Jahre alt und liebte Wein, Weib und Gesang. Er besaß das große Maschinenpatent C6 und war trotz seiner unorthodoxen Lebensweise ein ausgezeichneter Vorgesetzter, der seine Maschinenanlage in Schuss hatte. Er lebte nach der Devise „Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps“ und wurde sehr unangenehm, wenn sich jemand von seinen Leuten nicht daran hielt. Er war nicht arrogant und trank auch mit Mannschaftsgraden ein Bier, wenn man ihn an Land in einer Kneipe traf. An die übrigen Ingenieure und Offiziere, etwa an den Funker, erinnere ich mich nicht mehr. Sie hinterließen auch in meinem Tagebuch keine Spur.
Von Genua aus ging unser Schiff nach Livorno, wo wir anfingen, Stückgut für die USA zu laden. Auf dieser Fahrt wurde ich das erstemal mit der Knopfdrucksteuerung konfrontiert und stellte mich wohl sehr ungeschickt an, denn der Alte wurde ziemlich ungehalten und wollte mich zuerst von der Brücke jagen, brachte mir aber dann persönlich die Handhabung bei. Bei der Knopfdrucksteuerung hatte man anstelle des Steuerrads zwei gefederte Knöpfe unter einer querliegenden Haltestange. Man umfasste mit beiden Händen von oben diese Haltestange und drückte mit dem linken oder rechten Handballen den jeweiligen Druckknopf, also links für Backbord- und rechts für Steuerbordbewegungen. Dabei musste man auf den Ruderanlagenzeiger achten, von dem man die jeweilige Lage des Ruders ablesen konnte. Die Brücke war für die damaligen Verhältnisse sehr modern ausgerüstet: mit Kreiselkompass und Sichtfunkpeiler, besaß aber, wie damals die meisten Handelsschiffe, noch kein Radar. Auch eine Selbststeuerungsanlage fehlte noch und war erst auf wenigen Schiffen installiert. Radargeräte wurden damals übrigens von vielen Reedereien abgelehnt, da man der irrigen Ansicht war, dass man sich im Nebel zu sehr auf das Gerät verlassen und so Kollisionen fördern würde. Die Schiffe einiger Reedereien fuhren noch bis Ende der 60er Jahre ohne Radar, bis sie nach spektakulären Kollisionen durch ihre Versicherungen zur Ausrüstung mit Radar gezwungen wurden.
In Livorno hatte ich am Abend Landgang, und es war das erstemal, dass ich mich in Italien in Ruhe umschauen konnte. Der größte Teil der Besatzung hielt sich in einer Taverne am Hafen auf, wo es laute Musik, feurige Mädchen und das Glas Wein zu umgerechnet 30 Pfennigen gab. Da ich keinen Vorschuss aufgenommen hatte, beschränkte ich mich auf einen Spaziergang durch die Stadt, den ich sehr genoss. Alles kam mir, da ich bisher ja nur den kühlen Norden kennen gelernt hatte, exotisch und fremdartig vor. Die Menschen redeten schnell und gestikulierten dabei mit Händen und Armen, und die Mädchen waren dunkelhaarig und hübsch. Wenn man sie anschaute, lächelten sie einen an und schauten schnell weg, wenn sich ein anderer näherte. Gerne wäre ich in eines der kleinen Weinlokale gegangen, die es in großer Anzahl an der Straße gab und die alle voll besetzt waren. Aber ich hatte eben leider keine Lira in der Tasche. Als ich auf dem Rückweg an der Taverne vorbeikam, in der sich unsere Leute aufhielten, schallte mir gerade das nach dem Krieg viel gesungene Lied vom „Schööönen Westerwald“ entgegen. Bevor ich unsere Gangway erreicht hatte, hörte ich aus der Ferne noch die „blauen Dragoner“ reiten und wusste, dass die marschierende „deutsche Seele“ wieder zum Ausbruch gekommen war.
Von Livorno ging es nach Marseille. Dort wurden Helmuth und mir unsere Armbanduhren aus der Kammer geklaut. Wir hatten sie wie immer während der Arbeit an Deck in unseren Kleiderschränken liegen. Helmuth hatte, während er zur Toilette ging, unsere Kammer nur wenige Minuten offen gelassen und schon hatte sich ein Dieb eingeschlichen. Der, ein junger Algerier, war mir im Gang noch aufgefallen, weil er es so eilig hatte, an mir vorbei auf die Gangway zu kommen. Als ich Sekunden später bemerkte, dass auch meine Uhr verschwunden war, war er längst über alle Berge. Wir ärgerten uns furchtbar, denn für eine gute Uhr musste man damals fast einen Monat arbeiten und bei meinem schmalen Leichtmatrosen-Gehalt tat mir der Verlust besonders weh. Geklaut wurde im Hafen immer, und manchmal erwischten wir auch einen Dieb und dann ging es ihm sehr schlecht, einem ganz besonders, als er von der Kai her in ein geöffnetes Bullauge hineinlangte, um eine Jacke zu entwenden. Der Matrose, dem diese Jacke gehörte, kam in diesem Moment gerade in die Kammer und sah den Arm. Er drückte das Bullauge zu, so dass der Arm wie in einer Falle hängen blieb. Während er mit einer Hand den Dieb festklemmte, holte er mit der anderen seelenruhig sein Sturmfeuerzeug aus der Tasche und hielt es dem Spitzbuben einige Zeit brennend unter die Finger. Dessen tierischen Schrei werde ich nicht vergessen. Der ganze Hafen lief zusammen und der Strolch rannte, wie von Teufeln gehetzt, von dannen.
Von Marseille, unserem letzten Ladehafen, ging es in Richtung Atlantik und darüber hinweg in die Staaten. Zum erstenmal durchfuhr ich die nur 14 km breite Straße von Gibraltar zwischen den beiden Kontinenten Europa und Afrika und sah den berühmten Affenfelsen. Da ich am Ruder stand, erklärte mir der Alte die wechselvolle historische Vergangenheit dieses damals strategisch so wichtigen Felsens und Marinestützpunktes der Briten. Unsere Reise sollte über den Atlantik in die Großen Seen nach Kanada und die USA gehen, wo wir Toronto, Detroit, Chicago, Milwaukee und einige weitere Häfen anlaufen sollten. Da man bis dahin viele Schleusen und Kanäle passieren musste, wurden an die Schiffe besondere Anforderungen gestellt. Sie durften eine bestimmte Länge und Breite nicht überschreiten und mussten auch spezielle Vorrichtungen und Ausrüstungen besitzen. Aber davon später.
Während der Überfahrt mussten wir einem Hurrikan ausweichen und da unser Schiff nur ca. 3.000 Tonnen verdrängte, machten sich seine Ausläufer durch heftiges Rollen unangenehm bemerkbar, wobei sich das Schiff bis zu 30 Grad auf die Seite legte. Auch der Alte zeigte einige Merkwürdigkeiten, die mir zu denken gaben. Ich stand eines Nachts, es muss auf der Höhe der Azoren gewesen sein, bei heftigem Regen draußen in der Brückennock, als der Alte auf der Brücke erschien. Während er sich mit dem 3.Offizier unterhielt, musste er mich draußen, völlig durchnässt und frierend, gesehen haben. Denn gleich darauf trat er an die Tür und bemerkte mitleidig: „Stellen Sie sich mal ins Ruderhaus, Sie holen sich ja sonst die schönste Erkältung weg.“ Ich mag vielleicht fünf Minuten im Ruderhaus gestanden haben, als er aus dem Kartenraum zurückkam, mich sah und zu brüllen anfing: „Mann, sind sie verrückt geworden, sich hier im Ruderhaus zu verkriechen? Ihr Platz als Ausguck ist draußen in der Nock. Scheren Sie sich sofort nach draußen!“ Wir waren alle erstarrt und auch dem 3.Offizier, dem er Vorhaltungen machte, verschlug es die Sprache. Von dieser Begebenheit an wussten wir, dass mit unserem Alten irgend etwas nicht stimmte. Auch später erstaunte er uns mit einigen Überraschungen, die man nicht mehr als „Spleen“ abtun konnte.
Nach ca. 15 Tagen erreichten wir den St.Lorenz-Strom, und ich muss nun ein wenig auf die „Große-Seen-Fahrt“, wie sie allgemein genannt wird, eingehen. Sie war für die meisten von uns etwas ganz Neues. Wie schon erwähnt, durften die Schiffe wegen der engen Schleusen ein bestimmtes Tonnage- und Maßmaximum nicht überschreiten. Um nach Toronto, Cleveland, Chicago, Detroit, Milwaukee bis hinauf nach Fort Williams zu kommen, mussten wir mit unserem Schiff viele Schleusen und Kanäle passieren. Wenn eine Schleuse nicht gleich zur Einfahrt klar war, mussten wir davor festmachen und warten. Da es an diesen Wartepiers keine Festmacher von Land gab, musste auch jedes Schiff selbst sehen, wie es seine Leinen an Land brachte, um fest zu machen. Zu diesem Zweck hatten wir extra für die Große-Seen-Fahrt jeweils an Steuer- und Backbordseite hinter der Back sieben Meter lange waagerecht in Längsrichtung angebrachte Schwingbäume installiert. Daran hing je ein „Bootsmannstuhl“, der über zwei Blöcke mit einer langen Leine an einer Krampe befestigt war. Sollte das Schiff vor der Schleuse festmachen, musste man mit dem Vorschiff ganz dicht an die Wartekai heranfahren. Ein Mann wurde nun in den Bootsmannstuhl gesetzt und der Schwingbaum quer zum Schiff zur Landseite mit einer Gei (eine Art Flaschenzug) ausgeschwungen. Schwebte der Mann in seinem Stuhl frei über Land, wurde er mit der Leine über die Krampe heruntergelassen. Er konnte nun an Land springen und die an der Wurfleine befestigte Schiffsleine an Land ziehen und an einem Poller festmachen. Mit dieser Schiffsleine, die man als „Vorspring“ benutzte, fuhr das Schiff mit eigener Maschinenkraft längsseits der Wartekai, und man konnte anschließend alle übrigen Schiffsleinen festmachen. Das ging nicht immer so glatt, und manchmal konnte es Stunden dauern, bis das Schiff längsseits war, besonders bei ablandigem Wind oder nur sehr leicht beladenem Schiff. Auch war diese Angelegenheit für denjenigen, der im Bootsmannstuhl saß, nicht ungefährlich, da man durch die Schwimmweste sehr behindert war und schnell aussteigen musste, besonders, wenn das Schiff wieder von der Kai wegtrieb. Für diese spezielle Aufgabe wurden fast immer wir Leichtmatrosen eingeteilt, und so wurde ich im Laufe der Reise ein richtiger Experte für das „an Land jumpen“. Die Schleusen lagen meist weit außerhalb der Ortschaften und nur manchmal war ein kleines Dorf oder eine Farm in der Nähe. Nicht selten weideten Rinder in der Nähe und man kam sich vor wie auf dem Lande, was man ja im weitesten Sinne auch war.
Einmal mussten wir am frühen Nachmittag vor einer Schleuse festmachen, da ein Tornado angesagt war und der Schiffsbetrieb in diesem Gebiet vorsorglich eingestellt wurde. Über Rund- und Schiffsfunk von Land wurden die Bevölkerung und die Schifffahrt stündlich gewarnt, und unser 1.Offizier stellte fest, dass wir für die Ausmaße eines Wirbelsturms nicht genug Fender an Bord hatten. Als Fender werden heute meistens Autoreifen verwendet, die zwischen Schiffswand und Kaimauer aufgehängt als Polster die Reibung abfangen. Solche Fender konnten ein Schiff vor schweren Schäden schützen. Da in einer Entfernung von etwa fünf Kilometern einige Häuser zu sehen waren, schickte der Erste Helmuth und mich los, um ein paar alte, nicht mehr für den ursprünglichen Zweck zu gebrauchende Reifen zu besorgen. Bevor wir losgingen, schauten wir noch in unserem englisches Wörterbuch nach, wie Reifen auf Englisch heißen und merkten uns das Wort „tyre“.
Nach etwa 45 Minuten erreichten wir das erste Anwesen, welches nach einer Farm aussah, da in einem Pferch ein Haufen Schweine quiekten und in der näheren Umgebung Rinder weideten. Als wir in die Tür eines großen Wohnhauses traten, schoss ein großer Hund um die Ecke und bellte uns an. Wir waren auf einer typischen kleinen Farm gelandet. Der Farmer, ein noch junger drahtiger Mann mit Latzhose und seine Frau mit einem Haufen Kinder erwarteten uns an der Haustür. Helmuth, der ein passables Englisch sprach, erklärte den beiden, dass wir von einem deutschen Schiff kämen, welches an der Schleuse läge. Nun muss man sich vorstellen, dass die Deutschen damals, kurz nach dem 2. Weltkrieg, einen furchtbaren Ruf in Amerika hatten. Es verging dort nicht eine Woche, in der nicht mindestens drei alte Propagandafilme im Fernsehen gezeigt wurden, in denen die Deutschen als brutale, gewissenlose, sadistische Killer dargestellt wurden, die auf Befehl die grässlichsten Untaten verübten. Ich selber sah einmal einen solchen Streifen in Holland, in dem ein deutscher stiernackiger grinsender Soldat mit seinem rechten Kommissstiefel einen im Schlamm liegenden Säugling in den Boden stampfte. Alles in Großaufnahme.
Als die junge Frau hörte, dass wir Deutsche seien, presste sie ihre drei Kinder fest an sich und der Farmer bedauerte wohl im ersten Moment, dass er seine Flinte im Haus hatte liegen lassen. Aber als er uns etwa näher betrachtet hatte und nichts anderes sah, als zwei junge freundliche Seeleute mit ehrlichen Gesichtern, entspannte er sich und bat uns ins Haus. Die junge Frau verschwand mit den Kindern, und wir mussten uns hinsetzen und erzählen. Nach kurzer Zeit füllte sich die Wohnstube mit Leuten aus der Umgebung, die telefonisch unterrichtet worden waren und in ihren Autos kamen. Wir wurden wie Kuriositäten angestaunt, denn nun konnte man tatsächlich zum ersten Mal zwei leibhaftige „Nazis“ sehen. Bisher hatte man diese Monster nur im Fernsehen mit kaltem Schauern auf dem Rücken „bewundern“ können. Die junge Farmersfrau brachte uns Kuchen und Eiscreme und während wir zwei tüchtig mampften, mussten wir ununterbrochen Fragen über Germany, Nazis und den Krieg beantworten. Die biederen Leute stellten erstaunt fest, dass wir ganz normale unpolitische Ansichten hatten, wie sie selber auch. Man hatte hackenschlagende Monster erwartet und sah nun zwei junge Burschen, deren Ansichten sich kaum von ihren eigenen unterschieden. Die Zeit verging, und wir erinnerten uns mit Schrecken an unseren Auftrag, alte Autoreifen zu besorgen. Es war schon dunkel, und der Farmer fand in seinem Schuppen noch einen alten Reifen, den er uns gab. Der 1.Offizier hatte mit mindestens vieren gerechnet. Nach vielem herzlichen Händeschütteln, „Hallos“ und Einladungen verabschiedeten wir uns von diesen freundlichen Leuten. Der Farmer fuhr uns in seinem Wagen zu unserer Gangway, wo uns schon ein sehr grimmiger 1.Offizier erwartete. Zum Glück war der Tornado an uns vorbeigezogen und nachdem wir ihm alles erklärt hatten und auch der Farmer erzählte, was wir für „nice boys“ wären, hellte sich seine Miene auf, und uns wurde verziehen.
Bevor man in den USA an Land gehen konnte, musste man eine strenge Kontrolle über sich ergehen lassen. Legte das Schiff im ersten amerikanischen Hafen an, kamen außer den üblichen Behörden, wie Zoll und Coastguard auch Emigrationsbeamte und ein Arzt von der Gesundheitsbehörde an Bord. Die Emigrationsbeamten überprüften jeden, ob er ein gesuchter Nazi oder Kommunist war und im Fahndungsbuch stand. Auch musste man manchmal Fragen nach seiner Gesinnung beantworten. Anschließend wurde die „Schwanzparade“ abgehalten: Jedes Besatzungsmitglied, ausgenommen der Kapitän, musste dem Arzt sein Geschlechtsteil vorzeigen, welches dann vom Arzt mit einer Taschenlampe beleuchtet wurde. Auf sein Kommando „pusch and press“ musste man die Vorhaut zurückziehen und drücken. Kam nichts aus der Harnröhre, war man gesund und bekam, wenn man auch politisch für unbedenklich befunden wurde, seinen Landgangsschein, der einen Monat für alle Häfen der USA galt. Dieser Prozedur mussten sich ohne Ausnahme die Schiffe aller Nationen beugen, die die USA anliefen. Zu erklären war diese gesetzlich vorgeschriebene Maßnahme durch die übersteigerte Angst der Amerikaner vor Geschlechtskrankheiten. Die Franzosen machten später dieser entwürdigenden Behandlung ein Ende. Als das damals schnellste Schiff der Welt, die amerikanische „United States“ mit über tausend amerikanischen Passagieren Le Havre anlief, mussten alle männlichen Personen die gleiche Prozedur über sich ergehen lassen. Das brachte dann das Ende der berüchtigten „Schwanzparade“.
Gingen wir von Bord, fühlten wir uns wie im Schlaraffenland und konnten uns an den glitzernden Auslagen nicht satt sehen. Besonders die großen Warenhäuser wie z.B. „Sears“ hatten es uns angetan. Die USA waren für uns der Inbegriff der Freiheit und des Wohlstandes. Amerika besaß all das, wovon wir armen Nachkriegsdeutschen nur träumen konnten. Der Dollar war, neben dem englischen Pfund, die härteste Währung der Welt, und die USA waren die stärkste und reichste Nation der Erde. Es gab nichts, was man dort nicht für Dollars kaufen konnte, und das Warenangebot in den Geschäften schien uns unbegrenzt. Obgleich man für einen Dollar 4,25 DM zahlen musste, konnte man davon eine Menge kaufen. Für ein lbs. Kaffee zahlte man unter einem Dollar, während man in Deutschland für die gleiche Menge (500 g) fast 30 DM hinblättern musste. Eine gute Hose bekam man schon für 5 $ im Angebot. Bei uns zahlte man dafür fast 60 Mark, von Schuhwerk gar nicht zu reden. Selbst Waffen konnte man, wenn man über 21 Jahre alt war, ohne irgendwelche Formalitäten über dem Ladentisch kaufen und mitnehmen. Einen gebrauchten Straßenkreuzer gab es schon für 150 $ zu kaufen, für uns arme Deutsche unvorstellbar. Jeder Amerikaner konnte ohne irgendwelche behördlichen Formalitäten hinziehen, wohin er wollte, ohne sich an- oder abzumelden. Für uns Deutsche, die wir zum Obrigkeitsgehorsam erzogen worden waren, war dies ganz unvorstellbar. Als wir den Leuten erzählten, dass in Deutschland jeder polizeilich gemeldet sein muss und Zuwiderhandlung bestraft werden würde, stießen wir nur auf Unglauben. Auf die Frage an uns, ob wir denn noch immer in einem Polizeistaat leben würden, die Nazis wären doch besiegt, konnten wir ihnen keine sie befriedigende Antwort geben.
Wir löschten und luden unsere Ladung fast immer mit eigenem Ladegeschirr, da die meisten Häfen keine Kräne besaßen. Auch fehlte es vielen Schauerleuten an Windenerfahrung, so dass wir im Einvernehmen mit der Gewerkschaft schiffsseitig die Windenleute stellten. So bekamen wir zusätzlich zu unserer Heuer ca. 1,50 $ für eine Stunde Windenarbeit. Da in einigen Häfen bis in die Nacht gearbeitet wurde, kam im Laufe der Zeit für jeden Winchmann eine ansehnliche Menge Dollars zusammen. Diese Arbeit war natürlich sehr begehrt und wurde unter uns gerecht aufgeteilt. Es war auch das erstemal, dass ich mit elektrischen Winden arbeiten durfte, die ich bisher nicht kannte. Dass ich noch Junggrad und erst 18 Jahre alt war, wurde toleriert. Das Geld, das wir in bar ausgezahlt bekamen, gaben wir an Land mit vollen Händen für Kleidung aus. Mein ganzer Stolz war eine kurze lilafarbene Windjacke mit echtem Pumafell, welche ich in einem „Second hand shop“ für den unglaublich niedrigen Preis von 12 $ gekauft hatte. Diese Jacke, die fast neuwertig und unverwüstlich war, trug ich über drei Jahre beim Landgang und anschließend nachts auf Wache. Wir kauften uns auch in jedem amerikanischen Hafen riesige Mengen Eiscreme, da eine 2 lbs. (fast 1 Kg)-Packung nur knapp einen Dollar kostete und das Angebot alle Geschmacksrichtungen erfasste. Auch mit echtem Kaffee deckten wir uns ein, da die deutsche Speiserolle uns per Woche noch immer nur 50 g pro Mann zubilligte. Irgendeiner an Bord hat einmal die 50 g Bohnen gezählt und durch 7 geteilt, um die Zahl pro Tag zu ermitteln, es sollen ca. 10 bis 12 Bohnen gewesen sein.
In der Große-Seen-Fahrt haben wir die Amerikaner immer als hilfsbereite und großzügige Menschen kennen gelernt. Wann immer wir uns verlaufen hatten und nicht mehr weiter wussten, halfen sie uns, so gut sie konnten, und es kam nicht selten vor, dass, wenn die Zeit bis zur Abfahrt drängte, sie uns bis zur Gangway zurückfuhren. Diese Hilfsbereitschaft und Großzügigkeit habe ich auch in späteren Jahren immer wieder erlebt. In keiner anderen Gesellschaft ist sie so ausgeprägt und selbstlos wie in dieser großartigen Nation. Mögen die Amis auch manchmal großschnäuzig und überheblich sein, wenn man sie in der Not braucht, sind sie da.
An Bord der „Ilse E. Gleue“ herrschte eine ausgezeichnete Kameradschaft, und ich habe selten eine Crew erlebt, die so zusammenhielt wie wir. Wir brachten aus dem Mittelmeer meisten Wein und Stückgut in die Staaten und Stückgut und Hilfslieferungen zurück nach Europa. Auf einer Rückreise luden wir in Chicago unter anderem große, in Sacktuch eingenähte Ballen, die als Lumpen deklariert waren und als Hilfslieferungen nach Neapel gehen sollten. Da wir an Bord immer knapp an Putzlappen waren, gaben uns der Bootsmann und der Maschinenstorekeeper auf See den Wink, nachts mal in den Laderaum zu steigen und unseren Putzlappenvorrat etwas aufzustocken. „Aber nicht erwischen lassen!“, ermahnte uns der Bootsmann. Streng genommen war es ja Ladungsdiebsstahl, und darauf standen nach altem Seemannsgesetz drakonische Strafen bis zum Entzug des Seefahrtbuches. Kurz vor Mitternacht machten wir uns mit vier Mann, davon zwei von der Maschinencrew, ausgerüstet mit Taschenlampen, Messern und Sacknähmaterial, auf den Weg in den achteren Laderaum, wo die Ballen lagen.
Als wir den ersten Ballen öffneten, waren wir überrascht, fast neuwertige Uniformen aller Waffengattungen, teilweise mit Einheits- und Rangabzeichen zu finden, dazu Käppis, Mützen und Hemden. Ich muss zugeben, dass wir unter den damaligen Umständen keine Skrupel hatten, uns voll mit diesen „Lumpen“ einzudecken. Nach unserer Entdeckung herrschte im Laderaum ein Betrieb, wie auf einem Basar und es war ein Wunder, dass keiner der wachhabenden Offiziere etwas bemerkte. Nachdem wir die Ballen wieder fachgerecht zugenäht hatte, kamen wir überein, die Klamotten erst nach dem Löschhafen Neapel zu tragen. Wir wollten dann alle beim Einlaufen in den nächsten Hafen mit unserer neuen Montur an Deck und in der Maschine erscheinen. Bis dahin wollten wir strengste Geheimhaltung wahren, um Entdeckung unseres strafwürdigen Verhaltens zu vermeiden.
Auf dieser Rückfahrt geschah auch ein Ereignis, welches unseren Kapitän noch rätselhafter erscheinen ließ. Wieder auf der Höhe der Azoren gerieten wir diesmal in einen Sturm, der mit Windstärke 10 über uns hinwegfegte und unsere einzige Gangway, die auf der Luke festgezurrt war, losriss und total zerstörte. Da dies nachts geschah, sahen wir die Bescherung erst am frühen Morgen, als es hell wurde und das Unwetter abgeflaut war. Der Alte ließ unseren Zimmermann, einen älteren erfahrenen Mann, kommen und fragte ihn, ob er eine neue Gangway zimmern könne. Der wiegte bedenklich den Kopf und meinte, dass ihm dies mit dem beschränkten Material und Werkzeug unmöglich erscheine. Er schlage vor, eine neue Gangway über Funk zu bestellen und direkt an die Pier nach Neapel liefern zu lassen, wo wir anlegen würden. Der Alte dachte einen Augenblick nach und ließ sich dann vom Zimmermann den Werkstattschlüssel geben und verschwand in seiner Kammer.
Am nächsten Tag ließ er sich vom Bootsmann lange Schweißlatten, Planken und Stauholz aus den Laderäumen in die Zimmermannswerkstatt unter die Back bringen. Auch die alten Beschläge der zertrümmerten Gangway mussten nach vorne geschafft werden. Anschließend schloss er sich fünf Tage lang vorne in der Werkstatt ein. Wir sahen ihn morgens hinein- und abends herausgehen. Die ganzen Tage hörten wir ihn sägen und hämmern, und nur zu den Mahlzeiten bekamen wir ihn manchmal zu Gesicht. Der Zimmermann durfte die ganze Zeit seine Werkstatt nicht betreten und war sehr frustriert. Am fünften Tag rief der Alte den Bootsmann und einen Teil der Deckscrew nach vorne und mit vereinten Kräften wurde eine funkelnagelneue Gangway an Deck geschoben. An der neuen Gangway gab es nichts auszusetzen und selbst unser sehr geknickte Zimmermann musste dieser Arbeit Anerkennung zollen. Es war eine Meisterleistung, die uns den Alten noch rätselhafter machte.
Unser erster Löschhafen war also Neapel, wo wir auch unsere Hilfslieferung, die Ballen „Lumpen“ löschten. Wir lagen dort drei Tage und hatten so Gelegenheit, abends an Land zu gehen. Neapel war damals einer der berüchtigtsten Häfen, und man tat gut daran, nicht alleine an Land zu gehen. Meistens gingen wir in Gruppen zu drei oder vier Mann, und es war nicht ratsam, Wertsachen, wie Ringe und die Armbanduhr bei sich zu tragen. Das Geld steckten man sich am besten in einen Socken. Es gab dort Experten, die einem mit einem Griff die Uhr vom Arm rissen oder das Geld aus der Tasche zauberten. Anschließend gaben sie Fersengeld, und es war hoffnungslos, sie in den engen Gassen zu verfolgen. Einmal misslang einem Taschendieb so eine Attacke, und der Kerl bekam von uns so eine Tracht Prügel, dass er sie bestimmt in seinem Leben nie wieder vergessen konnte. Gleich am Eingang zum Hafen stand abends ein ganzer Haufen von Nutten und Straßenjungen, die ihrem Gewerbe nachgingen. Die Angehörigen der 6. US-Flotte, die in Neapel stationiert war, machten sich ein Vergnügen daraus, die Nutten zu bezahlen, um dann dabei zuzuschauen, wie diese von den Straßenjungen gebumst wurden. Wir selbst gingen in die Tavernen am Hafen, wo es Wein, Weib und Gesang gab. Das Glas Wein kostete umgerechnet nicht mehr als 30 Pfennige, und die Mädchen waren nicht prüde. Aber Vorsicht war geboten, denn Neapel war berühmt für seinen Tripper und mancher Seemann stellte nach dem Auslaufen fest, dass er sich die „Gießkanne verbogen“ hatte. Damals waren die Gonokokken noch nicht so abgehärtet wie heute und nach zwei Spritzen á 400.000 i.E. Penicillin war der „Kavaliersschnupfen“ meistens auskuriert. Nach so einer rauschenden napolitanischen Ballnacht mit dem vielen Weingenuss hatte man am nächsten Morgen einen sehr schweren Kopf und schwor sich, abends früh in die Koje zu gehen. Aber am Abend waren meistens alle guten Vorsätze vergessen und man befand sich erneut in „dulci jubilo“, schwang wieder das Tanzbein und genoss die „Dolce vita“.
Unser nächster Hafen war Livorno, und hier wollten wir alle beim Anlegen in unseren US-Uniformen erscheinen. Nach dem Signal „Klar vorne und achtern“ tauchten wir alle in unseren „Paradeuniformen“ auf unseren Stationen auf, und es war das erste Mal an Bord, dass es unserem Alten, der wieder gestiefelt und gespornt in seinem blauen Dress auf der Brücke stand, die Sprache verschlug. Auch bei den Leuten an der Kai erregten wir beim Anlegen beträchtliches Aufsehen. Da unsere Uniformen noch mit allen Einheits- und Rangabzeichen versehen waren, wirkte unser Anblick besonders beeindruckend. Den Vogel schoss unser Gefechtsrudergänger ab, der in einer blauen Luftwaffenuniform der US-Air Force mit den Streifen eines Mastersergeanten erschien. Der Alte sah neben ihm richtig blass aus. Nach dem Anlegen musste der Bootsmann, der eine Heeresjacke trug, beim Alten erscheinen, der wissen wollte, wo unsere Uniformen herkämen. Aber unsere Antwort war vorher abgesprochen. Natürlich hatten wir die Klamotten in Chicago in einem „Military-surplus“-Laden für 2 $ das Stück gekauft. Verbieten konnte er es uns nicht, denn auf einem Handelsschiff, wo es keinen Uniformzwang für die Crew gab (nur die Offiziere trugen Uniformen), konnte man praktisch tragen, was man wollte, solange man seine Arbeit ordentlich machte. Wie uns der 1.Offizier später mitteilte, war der Alte sichtbar verärgert und sprach von Kinderkram und Karneval und ließ sicherheitshalber die Ladelisten aus Amerika durchforsten. Aber die Ballen waren eindeutig als „Lumpen“ deklariert und in den Listen stand nichts von Uniformen. Wir hatten unseren Spaß gehabt, und der Alte trat beim Einlaufen künftig nicht mehr ganz so theatralisch auf der Brücke auf.
Wir hielten uns jetzt nur noch im Mittelmeer auf, und ich lernte die wichtigsten Häfen in der Türkei, Griechenland und an der ganzen nordafrikanischen Küste kennen. Manchmal machten wir auch einen Abstecher in das Schwarze Meer nach Bulgarien oder gingen auch mal ein Stück über den Atlantik nach dem marokkanischen Casablanca. In Piräus in Griechenland sah ich auch zum erstenmal Hedwig, die als berühmteste „Waschfrau“ in der ganzen deutschen Handelsschifffahrt bekannt war. Hedwig war damals 32 Jahre alt und hatte ein hübsches, klassisch-nordisches Gesicht, blaue Augen und schönes blondes Haar, dazu eine ausgezeichnete Figur. Als Strandgut des Krieges soll sie als junge Wehrmachtshelferin nach dem Krieg in Griechenland hängen geblieben sein. Ihre Odyssee muss, sollte sie jemals geschrieben werden, ein erschütterndes Zeitdokument ergeben. Durch besondere behördliche Beziehungen besaß sie eine Genehmigung, im Hafen an Bord deutscher Schiffe zu gehen und für die Besatzungen Wäsche zu waschen. Ich möchte nicht wissen, wie viele Bestechungen und Erniedrigungen ihr diese Genehmigung gekostet haben muss.
Natürlich war diese ganze „Wäscherei“ nur eine Tarnung für ihr eigentliches „Gewerbe“. Meistens hatte sie noch eine Freundin zur Verstärkung mit, und mit vereinten Kräften bedienten sie nicht selten eine ganze Besatzung. Da Hedwig, wie schon erwähnt, gut aussah und ein angenehmes Wesen hatte, war sie auch bei den Offizieren gefragt. Ihre Tätigkeit erfolgte nach strengen hygienischen Regeln und nur mit Kondomen und ich habe nie gehört, dass sich jemand bei ihr angesteckt hätte. Ihr Preis war im Vergleich zur Konkurrenz an Land nicht billig, und Hedwig war für ein Extrageschenk in Form von Parfüm oder Seife sehr dankbar. Um jede Vermutung gleich im Keim zu ersticken, ich habe ihre Künste nicht selber getestet, halte es aber für angebracht, sie zu erwähnen, denn sie war damals in der Seefahrt eine „bekannte Persönlichkeit“, und es wurde auch in späteren Jahren von vielen Seeleuten über sie erzählt. Ich habe aber nie eine abfällige Bemerkung über sie gehört.
Wir fuhren manchmal auch Wein in Holzfässern als Ladung, meistens aus Italien. Es gehörte zu unseren Aufgaben, die Fässer unterwegs auf See zu kontrollieren, ob sie auch dicht waren, denn manche Hafenarbeiter pflegten während des Ladens einige Fässer mit einem kleinen Bohrer anzuzapfen und die Löcher dann wieder mit einem Holzpflock zu verschließen. Durch die Schiffsbewegungen lösten sich diese Pflöcke oft und der Wein lief dann aus. Als wir bei unserer ersten Ladungskontrolle knöcheltief im Wein wateten, brauchten wir einige Zeit, um die Ursache zu finden. Durch Sonneneinwirkung auf die Bordwand und das Oberdeck hatte sich die Luft im Laderaum stark erwärmt. Dadurch bildete sich durch die Verdunstung des ausgelaufenen Weins eine enorme Alkoholwolke, die wir nicht wahrnahmen. Erst, als wir wieder an die frische Luft kamen, merkten wir, dass wir durch die eingeatmeten Dämpfe ganz schön alkoholisiert waren. Als wir dann auf der Brücke erschienen, um dem 1.Offizier im Beisein des Alten Meldung zu erstatten, konnten wir uns kaum noch auf den Beinen halten. Natürlich glaubte uns keiner, dass wir nicht einen Schluck getrunken hatten, und der erboste Alte drohte uns mit schwerwiegendsten Konsequenzen. Nun ging der 1.Offizier selbst in Begleitung des Dritten und eines Matrosen der Wache in den Laderaum, um den Schaden und seine Ausmaße zu besichtigen. Als auch diese drei nach einiger Zeit ziemlich angesäuselt vor dem entsetzten Alten erschienen, muss ihm ein Licht aufgegangen sein, denn er ließ sofort die Ladeluke öffnen und lüften. Wie es sich herausstellte, bestand die Ursache des alkoholischen Fußbades nicht nur in den angezapften Fässern, sondern außerdem waren einige weitere 200-Liter-Fässer durch die Schlingerbewegungen des Schiffes aus ihren Laschings gerutscht und leckgeschlagen. Der Alte ließ die Bilgenpumpen anstellen und der ausgelaufene Wein wurde über die Laderaumbilge in das klare Mittelmeer gepumpt. Die Fische im Fahrwasser werden anschließend ganz schön „high“ gewesen sein.
Eines Tages wurden wir auf See davon unterrichtet, dass unser Schiff an die Reederei Schulte & Bruns in Emden verkauft worden sei. Es wurde uns freigestellt, mit den gleichen Bezügen an Bord zu bleiben oder im nächsten Anlaufhafen Neapel abzumustern. Im Falle des Abmusterns würde die Reederei die Rückreisekosten zahlen. Der größte Teil der Crew und der Offiziere, darunter auch der 1.Offizier, wollten abgelöst werden. Unser Alter, der 1.Ingenieur, der 1.Koch, der Bootsmann und ich als einziger von der Deckscrew entschieden uns, an Bord zu bleiben.
Lesen die den 2. Teil im Buch weiter: Matrose
Schiffsbilder
Informationen zu den maritimen Büchern des Webmasters finden Sie hier:
zur gelben Zeitzeugen-Bücher-Reihe des Webmasters:
© Jürgen Ruszkowski

zur gelben Zeitzeugen-Bücher-Reihe des Webmasters:

maritime gelbe Buchreihe bei amazon
© Jürgen Ruszkowski
Schiffsbilder
Seefahrt damals
Seefahrtserinnerungen - maritime_gelbe_Buchreihe - Seefahrtserinnerungen

Maritimbuch - Seeleute - unterwegs - Zeitzeugen des Alltags
Schiffsbilder
Informationen zu den maritimen Büchern des Webmasters finden Sie hier:
zur gelben Zeitzeugen-Bücher-Reihe des Webmasters:
© Jürgen Ruszkowski

zur gelben Zeitzeugen-Bücher-Reihe des Webmasters:
© Jürgen Ruszkowski
Maritime books in German language: fates of international sailors
Los libros marítimos en el idioma alemán: los destinos de marineros internacionales:
zu meiner maritimen Bücher-Seite
navigare necesse est!
Maritime books in German language: fates of international sailors
Los libros marítimos en el idioma alemán: los destinos de marineros internacionales:
Diese Bücher können Sie direkt bei mir gegen Rechnung bestellen: Kontakt:
Zahlung nach Erhalt der der Ware per Überweisung.
Informationen über die Buchpreise finden Sie auf der Bücher-Seite
Zahlung nach Erhalt der der Ware per Überweisung.
Bücher in der gelben Buchreihe" Zeitzeugen des Alltags" von Jürgen Ruszkowski:
Diese Bücher können Sie für direkt bei mir gegen Rechnung bestellen: Kontakt:
Zahlung nach Erhalt der der Ware per Überweisung.
|
Meine Postadresse / my adress / Los orden-dirección y la información extensa:
Jürgen Ruszkowski, Nagelshof 25,
D-22559 Hamburg-Rissen,
Telefon: 040-18 09 09 48 - Anrufbeantworter nach 30 Sekunden -
Fax: 040 - 18 09 09 54
Bestellungen am einfachsten unter Angabe Ihrer Anschrift per e-mail
|

|
Bücher in der gelben Buchreihe" Zeitzeugen des Alltags" von Jürgen Ruszkowski:
Wenn Sie an dem Thema "Seeleute" interessiert sind, gönnen Sie sich die Lektüre dieser Bücher und bestellen per Telefon, Fax oder am besten per e-mail: Kontakt:
Meine Bücher der gelben Buchreihe "Zeitzeugen des Alltags" über Seeleute und Diakone sind über den Buchhandel oder besser direkt bei mir als dem Herausgeber zu beziehen, bei mir in Deutschland portofrei (Auslandsporto)
Bestellungen am einfachsten unter Angabe Ihrer Anschrift per e-mail
Sie zahlen nach Erhalt der Bücher per Überweisung.
Maritime books in German language: fates of international sailors
Los libros marítimos en el idioma alemán: los destinos de marineros internacionales:
Los libros en el idioma alemán lo enlatan también, ( + el extranjero-estampilla), directamente con la editor Buy de.
maritime gelbe Buchreihe
|
Band 1 - Band 1 - Band 1
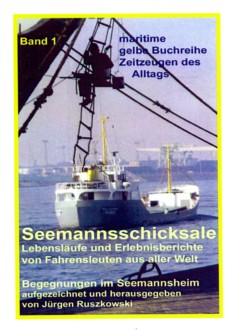
á 13,90 €
Bestellung
kindle- ebook für ca. 8 € bei amazon
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks-
B00AC87P4E
|
Band 2 - Band 2 - Band 2
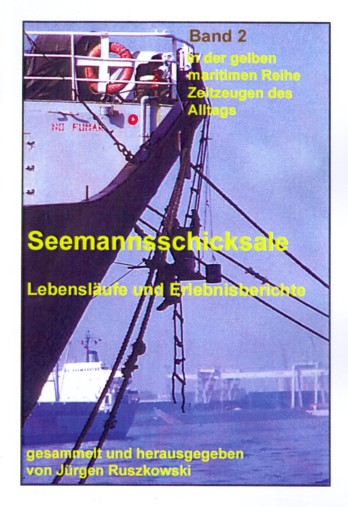
€ á 13,90
kindle-ebook für ca. 8 € bei amazon
auch als kindle-ebook bei amazon
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
B009B8HXX4
|
Band 3 - Band 3

á 13,90 € - Buch
auch als kindle-ebook bei amazon
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
B00998TCPS
|
|
Band 4 - Band 4 - Band 4
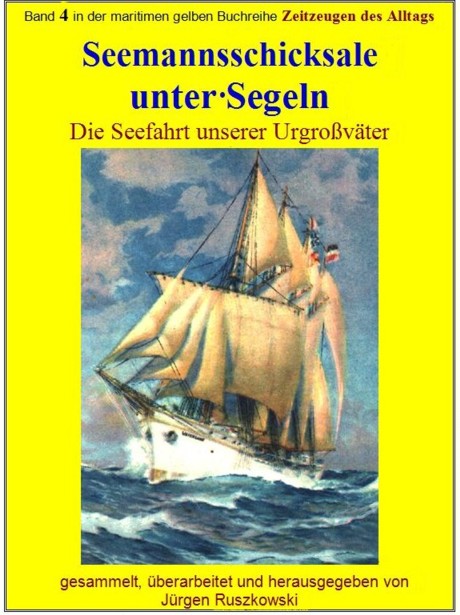
á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 5 - Band 5
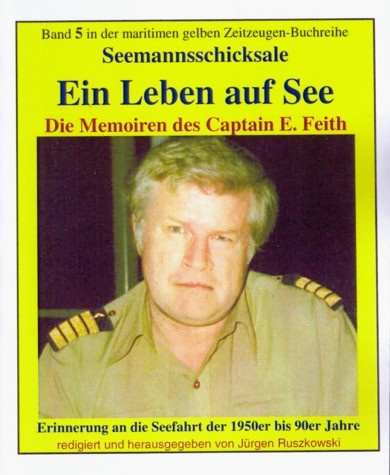
á 13,90 €
Bestellung
kindle-ebook für ca. 8 € bei amazon
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 6 - Band 6
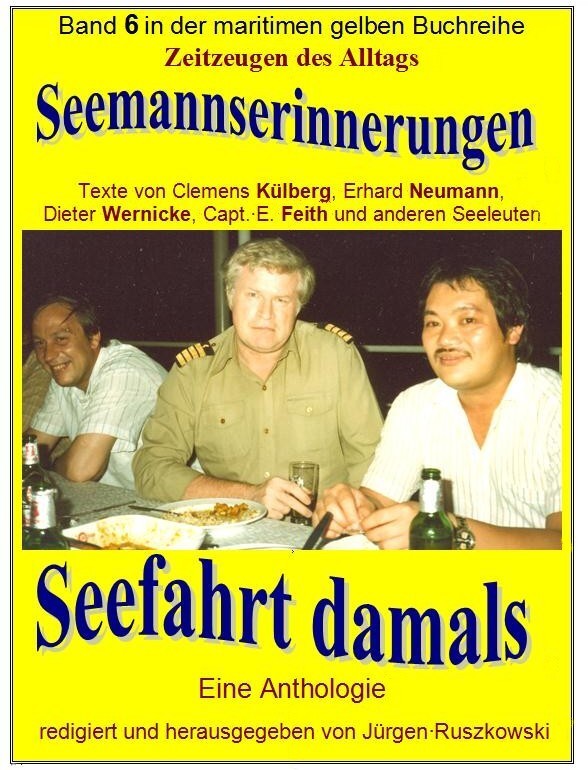
á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
|
Band 9 - Band 9
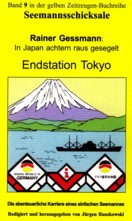
á 13,90 €
Bestellung
|
Band 10 - Band 10
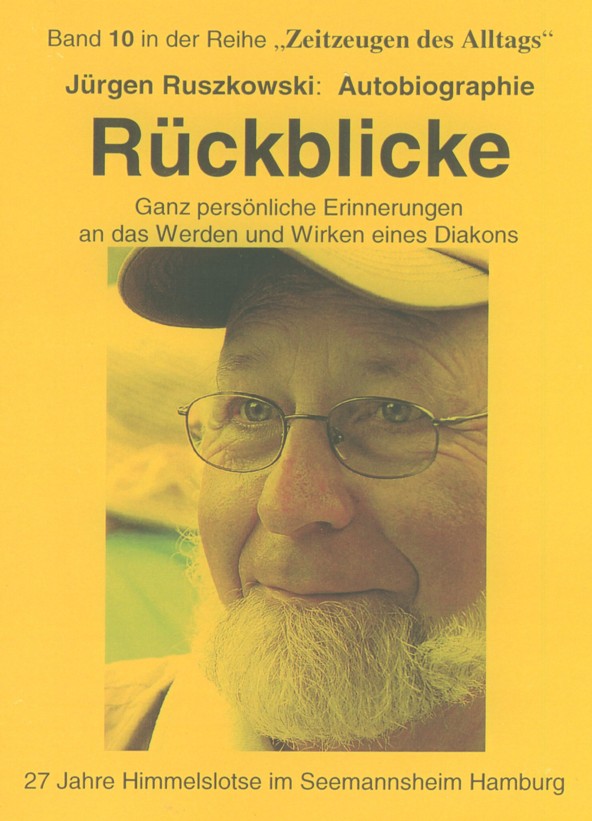
á 13,90 €
Bestellung
kindle-ebook für nur ca. 4,80 € bei amazon
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 11 - Band 11
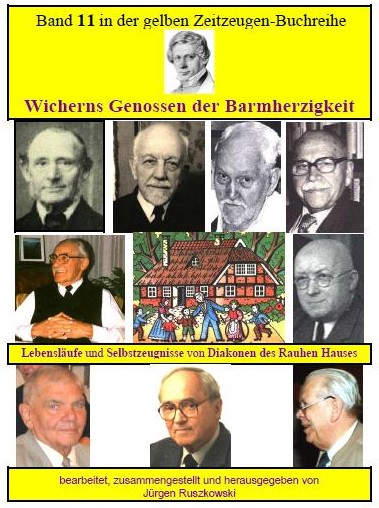
á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
|
Band 12 - Band 12

Diakon Karlheinz Franke
leicht gekürzt im Band 11 enthalten
á 12,00 €
eventuell erst nach Neudruck lieferbar
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 13 - Band 13
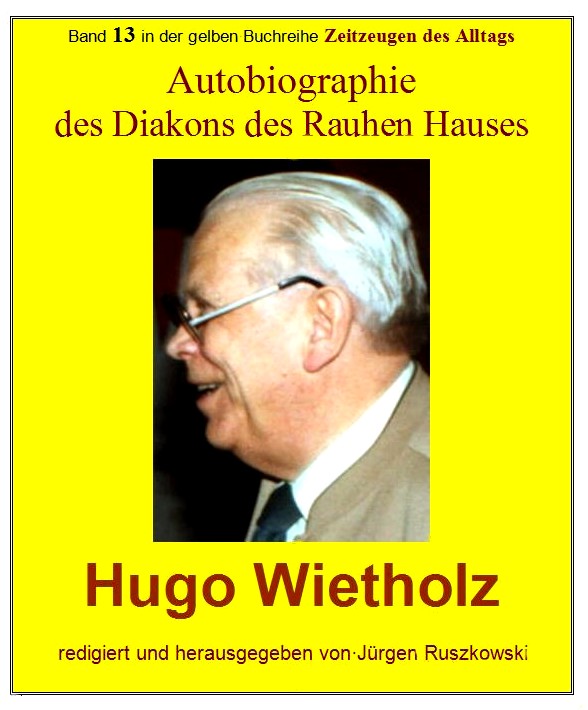
gekürzt im Band 11 enthalten
á 13,90 €
Bestellung
kindle-ebook für ca. 5 € bei amazon
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 14 - Band 14

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
|
Band 15 - Band 15
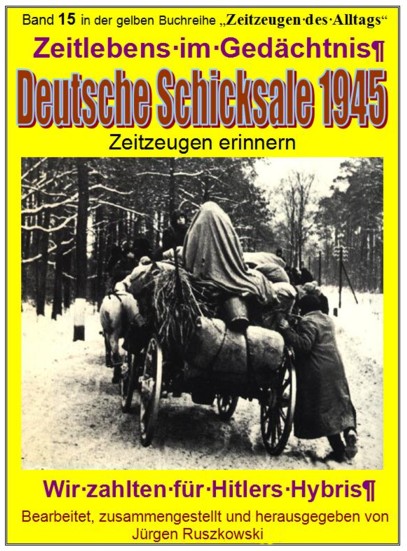
á 13,90 €
Bestellung
kindle-ebook für ca. 8 € bei amazon
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 17 - Band 17
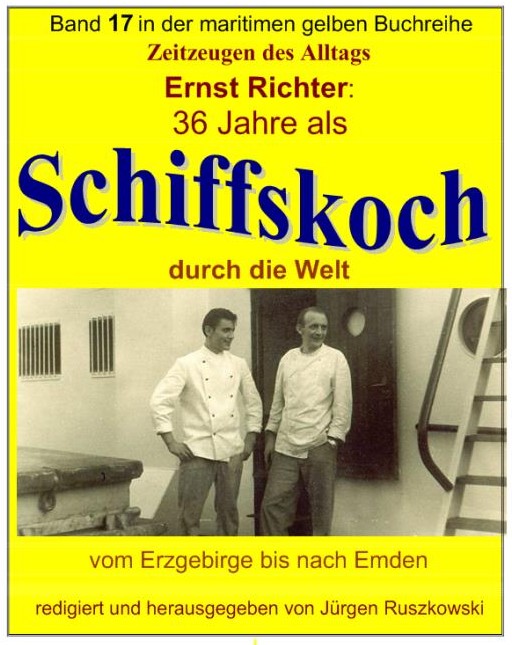
á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 18 - Band 18

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
|
Band 19 - Band 19

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 20 - Band 20
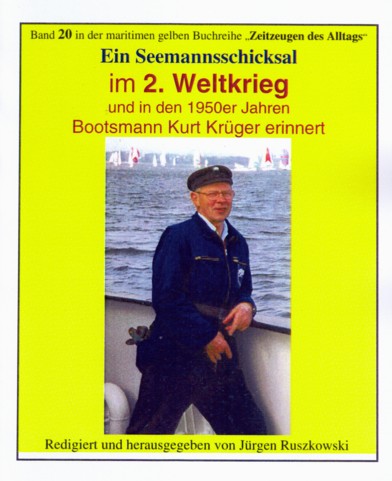
á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 21 - Band 21

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
|
Band 22 - Band 22

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 23 - Band 23

á 12,00 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 24 - Band 24
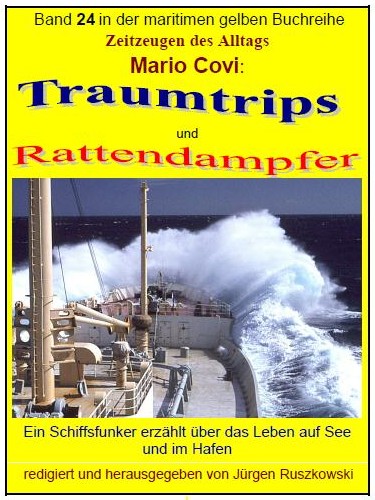
á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
|
Band 25 - Band 25
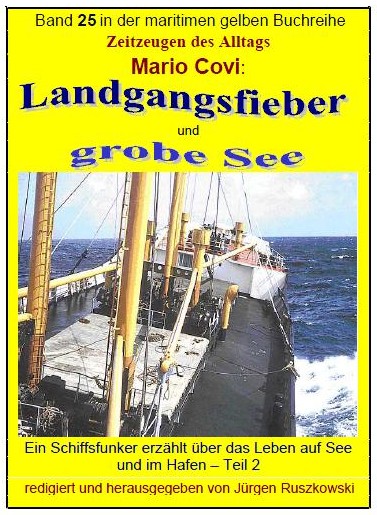
á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 26 - Band 26

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 27 - Band 27

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
|
Band 28 - Band 28

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 29 - Band 29
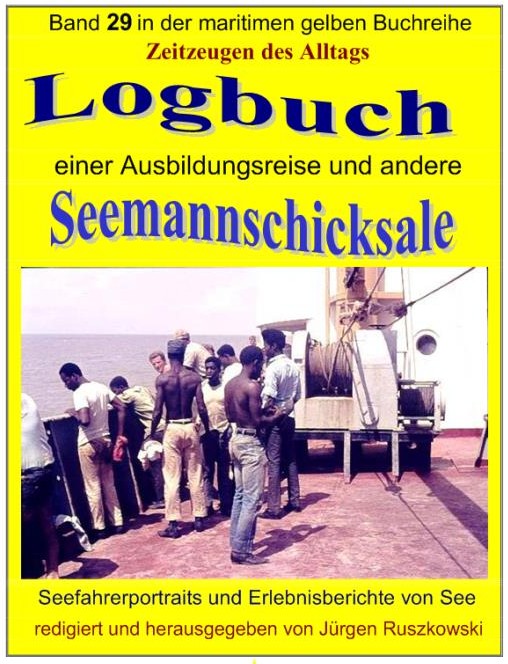
á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 30 - Band 30
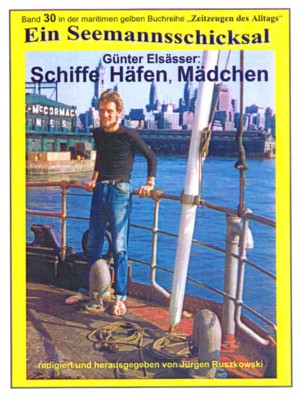
á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
|
Band 31 - Band 31

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 32 - Band 32
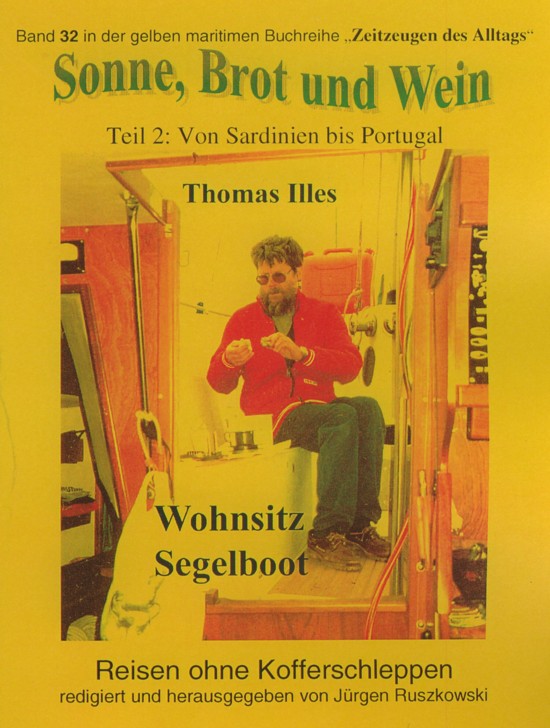
á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 33 - Band 33

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
|
Band 34 - Band 34

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 35 - Band 35

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 36 - Band 36

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
|
Band 37 - Band 37

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 38 - Band 38

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 39 - Band 39
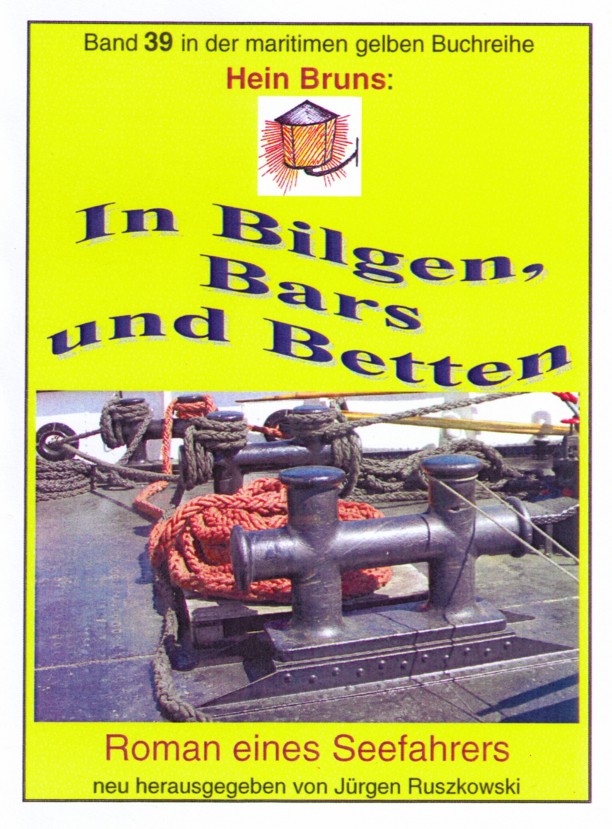
á 13,90 €
Bestellung
kindle-ebook für ca. 8 € bei amazon
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
|
Band 40 - Band 40

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 41 - Band 41

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 42 - Band 42

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
|
Band 43 - Band 43 - Band 43

á 12,00 €
Bestellung
kindle-ebook für ca. 5 € bei amazon
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 44 - Band 44 - Band 44

á 13,90 €
Bestellung
kindle -ebook für ca. 8 € bei amazon
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 45 - Band 45 - Band 45
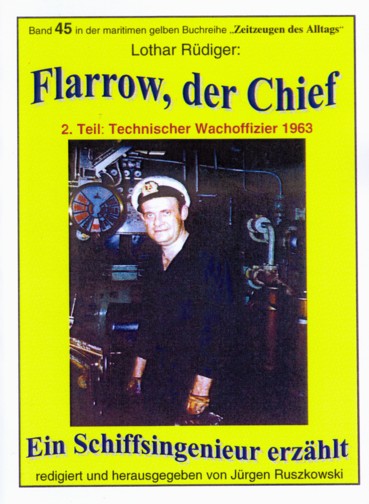
á 13,90 €
Bestellung
kindle -ebook für ca. 8 € bei amazon
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
|
Band 46 - Band 46 - Band 46
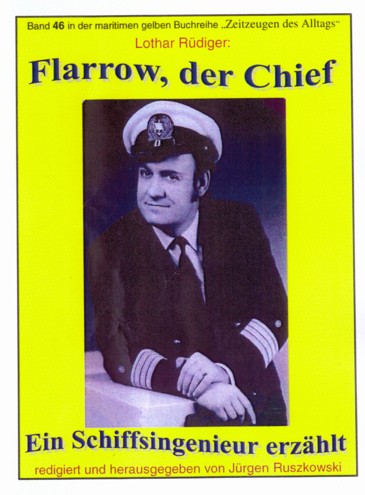
á 13,90 €
Bestellung
kindle -ebook für ca. 8 € bei amazon
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 47 - Band 47 - Band 47

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 48 - Band 48

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
|
Band 49 - Band 49 - Band 49

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 50 - Band 50 - Band 50

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
. Band 51 - Band 51 - Band 51

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
|
Band 52 - Band 52

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 53 - Band 53

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 54 - Band 54
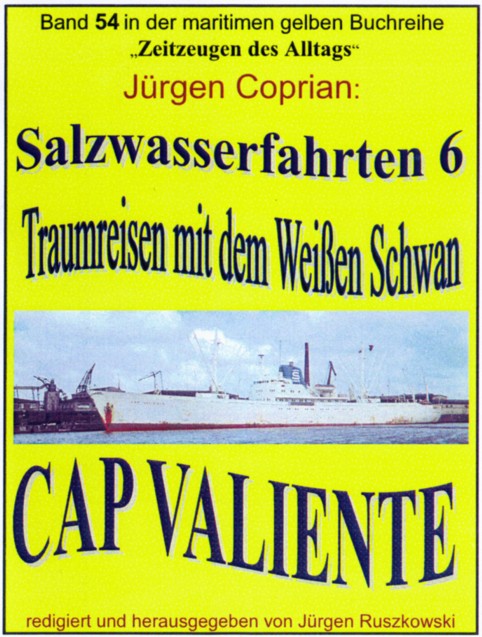
á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
|
Band 55 - Band 55

á 13,90 €
Bestellung
auch als kindle- ebook für ca. 8 € bei amazon
kindle-ebook bei amazon
weitere Bände sind geplant
|
Band 56 - Band 56

nicht mehr lieferbar
|
Band 57 - Band 57 - Band 57

á 14,90 €
Bestellung
kindle-ebook für ca. 8 € bei amazon
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
|
Band 58 - Band 58 - Band 58

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 59 - Band 59

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 60 - Band 60
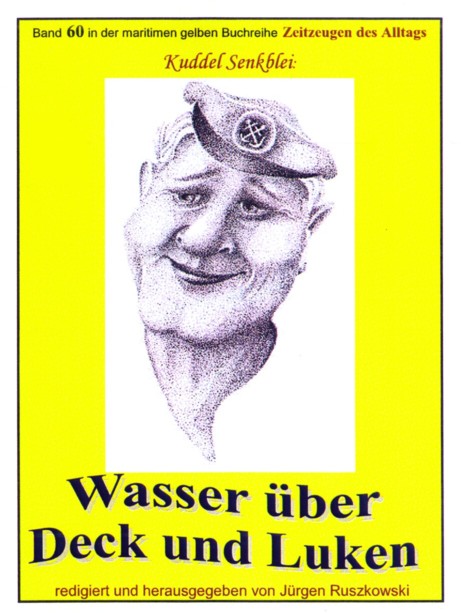
á 13,90 €
Bestellung
kindle-ebook für ca. 8 € bei amazon
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
|
Band 61 - Band 61
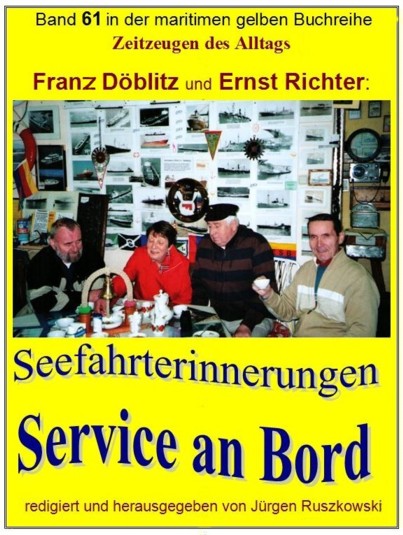
á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 62 - Band 62

á 13,90 €
Bestellung
kindle-ebook für ca. 8 € bei amazon
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
- Band 63 - Band 63 -

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
hier könnte Ihr Buch stehen
|
|
- Band 64 - Band 64 - Band 64

á 13,90 €
Bestellung
- kindle-ebook -
|
Band 65 - Band 65 - Band 65
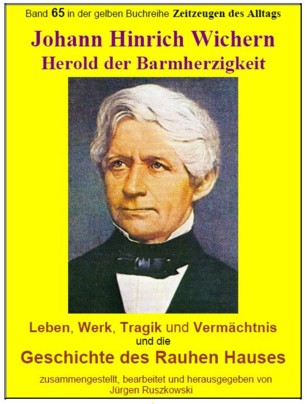
Johann Hinrich Wichern
á 13,90 €
Bestellung
kindle-ebook bei amazon f0r 7,79 € oder 10,30 US$
|
- Band 66 - Band 66 - Band 66
Bernhard Schlörit:
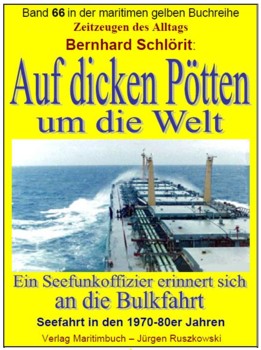
- Auf dicken Pötten um die Welt -
á 13,90 €
Bestellung
|
|
- Band 67 - Band 67 -

Schiffsjunge 1948-50
á 13,90 €
Bestellung
|
Band 68 - Band 68 -
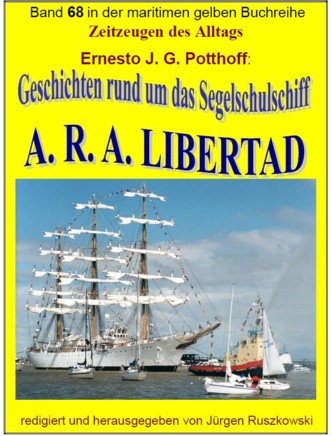
Ernesto Potthoff:
Segelschulschiff LIBERTAD
hier könnte Ihr Buch stehen
alle Bücher ansehen!
|
- Band 69 - Band 69 - Band 69 - Band 69 -

Ernst Steininger:
á 13,90 €
Bestellung
ebbok für 7,49 € oder 10,29 US$
|
Buchbestellungen
Viele Bände sind jetzt auch als amazon-Direktdruck-Printbücher zu erhalten:
Band 1 - Band 2 - Band 4-1 Alfred Tetens - Band 4-b Anthologie 2015 - Band 5 - Band 6 - Band 15 = neu bearbeitet - Band 17 = neu bearbeitet - Band 18 = neu bearbeitet - Band 19 - Band 20 - Band 21 - Band 22 - Band 26 - Band 27 - Band 30 - Band 31 - Band 32 - Band 33 - Band 36 - Band 37 - Band 39 - Band 40 - Band 41 - Band 42 - Band 43 - Band 44 - Band 45 - Band 46 - Band 47 = neu bearbeitet - Band 48 - Band 58 - Band 59 - Band 60 - Band 64 - Band 65 - Band 68 - Band 69 - Band 70 - Band 71 - Band 73 - Band 76 - Band 78 - Band 79 -
weitere websites des Webmasters:
Diese Seite besteht seit dem 01.04.2003 - last update - Letzte Änderung 17.06.2018
Jürgen Ruszkowski © Jürgen Ruszkowski © Jürgen Ruszkowski
|

